Ein paar Fake-News weniger
Kann ein Verbot einer Zeitung gut für die Pressefreiheit sein?
Das Compact-Magazin von Jürgen Elsässer wurde von Innenministerin Nancy Faeser verboten. So ging es in den Morgenstunden durch die Presselandschaft und vor allem durch Social Media. Zensur, das Ende der Meinungsfreiheit, die linksgrünversiffte Woke-Diktatur lasse ihre Maske fallen, poltern einige. War Compact nur eine unbequeme oppositionelle Stimme?
Donald Trump wurde nach seiner ikonisch in die Luft gereckten Faust als Held gefeiert. Gut, das taten einige. Die Wahlniederlage von Marine Le Pen wurde bedauert. Victor Orbán als Friedensbringer
eingeordnet, Wladimir Putin sowieso und die NATO, die EU, die Bundesregierung, das sind natürlich alles Kriegstreiber.
Zudem wurde natürlich immer wieder gegen Migranten, gegen Juden, gegen die Grünen gehetzt, klar Stellung für die AfD bezogen und unter anderem der patriotische Höcke-Taler als Wertanlage
angeboten oder ein Sommerfest in der kommenden Woche mit Martin Sellner und Maximilian Krah auf die Beine gestellt. Kurzum: Compact bediente alles, was rechte Bubbles hören wollten,
Wahrheitsgehalt spielte in der Berichterstattung eine untergeordnete Rolle.

Seit 2020 wurde das Magazin vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft, da es sich „revisionistischer, verschwörungstheoretischer und fremdenfeindlicher Motive“ bediene, wie Präsident Thomas Haldenwang begründete. Seit 2021 gilt es als gesichert rechtsextrem. Innenministerin Faeser bezeichnete es als Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene, das gegen unsere Demokratie hetze und somit geistiger Brandstifter sei.
Mit dem Verbot des Medienunternehmens Elsässers sollen nun also Publikationen unterbunden werden, die verfassungsfeindlich sind, außerdem ist es aber ein Vorgehen gegen jene, die Hass schüren.
Dass diejenigen, die sich von Compact vertreten fühlen, das also als Verbot einer Opposition hinstellen, ist logisch.
Ist es tatsächlich ein rechtsstaatlicher Eingriff in die Pressefreiheit? Dazu wiederum lohnt sich ein Blick in den Pressekodex, der journalistische Leitlinien vorgibt. Dort heißt es ganz oben,
dass die Wahrheit und die Menschenwürde geachtet werden müssen. Das sei die Grundlage für die Glaubwürdigkeit von Medien.

Weiter geht es mit sorgfältiger Recherche, dem Schutz der Persönlichkeit, unangemessener Sensationsberichterstattung und unter anderem eben auch eine klare Ablehnung von Diskriminierungen. Es sind Regeln, die zum Teil an die Grundrechte erinnern und diese sozusagen spezifizieren. Sie erklären, was Medien dürfen und wo ethische Grenzen überschritten werden.
Selbstverständlich ist Ethik für die Pressefreiheit ungemein wichtig. Freie Presse, die alles behaupten darf, unabhängig von Fakten und von dem, was sie damit anrichtet, ist nichts wert. Eine
verantwortungsvolle freie Presse hingegen ist ein mächtiges Instrument in einer Gesellschaft und das wird ja weltweit auch immer wieder bewiesen.
Auf der anderen Seite kursierten auf der Welt gefühlt noch nie so viele Fake News wie heute. Gründe dafür können in sozialen Medien oder allgemein in der digitalisierten Informationsflut gesehen
werden, aber ganz gezielt eben auch bei Medien, die Ideologien verfolgen, die Unsicherheiten bewusst nutzen, um Stimmungen zu schüren.

Gerade populistische rechte Medien beherrschen diese Verdrehung der Wahrheit ziemlich gut und wurden in den letzten Jahren immer offensiver in den offensichtlichen Fake News, die sie verbreiten. Verschwörungstheorien bekommen eine Bühne, ganz aktuell bereits wenige Stunden nach dem Attentat auf Trump, bevor überhaupt nur annähernd Fakten bekannt sind.
Bei vielen Menschen verfängt Angst, die damit erzeugt wird, verfängt Misstrauen gegen Regierungen, gegen Medien, gegen die Wissenschaft. Das widerspricht eindeutig dem Pressekodex wie überhaupt
jeglicher Ethik und destabilisiert Gesellschaften. Insofern ist es im Sinne der Pressefreiheit sowie im Sinne einer wehrhaften Demokratie sogar dringend notwendig, dass gegen geistige
Brandstifter vorgegangen wird und nicht jeder in die Welt setzen darf, was er möchte.
Damit sage ich ja nicht, dass alle anderen alles richtig machen, doch in unserer Medienlandschaft sind nun einmal einige beheimatet, die sich nicht an Fakten, nicht an allgemeinen Spielregeln
orientieren, sondern bewusst desinformieren, beeinflussen, aufhetzen wollen. Genau die sind eine Gefahr für die Pressefreiheit und letztlich die Freiheit allgemein.
Wer will die Welt brennen sehen?
Buchtipp: Marc-Uwe Kling - Views
Damals, als ich noch im Studium war, begann ich meine spätere journalistische Laufbahn mit Literaturrezensionen. Dem bin ich bis heute treu gebieben, lese nach wie vor viel und veröffentliche auch relativ regelmäßig Rezensionen. Weil ich Literatur nun einmal für unglaublich wichtig halte. Für die Bildung, für die Kreativität und eben auch für die Gesellschaft. Was also spricht dagegen, auch hier ab und zu Bücher vorzustellen, die ich für besonders lesenswert halte?
In den sozialen Netzwerken geht ein Video viral, das eine brutale Vergewaltigung zeigt. Das Opfer, ein junges Mädchen aus dem Harz, das kurz zuvor spurlos verschwunden ist. Die Täter, drei Männer mit dunkler Hautfarbe, also offenbar Migranten. Kurzum: gesellschaftlicher Sprengstoff.
Dies ist die Ausgangslage für Marc-Uwe Klings „Views“, ein Buch, das laut Cover nicht etwa ein Krimi oder Thriller, sondern schlicht ein Roman ist. Trotzdem ist es nach den humoristisch-skurrilen
„Känguru-Chroniken“, der Science-Fiction-Saga „Qualityland“ und Ausflügen in weitere literarische Genres des zu großer Popularität gelangten Kleinkünstlers wieder einmal etwas ganz anderes. Oder?

Nun ja, das Känguru ist kommunistisch und entgegen seiner biologischen Natur ziemlich bissig, die Zukunft in Qualityland ebenso Dystopie wie Satire auf unsere Gegenwart und auch sonst ist Marc-Uwe Kling in seinem Schaffen nicht eben unpolitisch. So ist auch „Views“ in erster Linie ein Gesellschaftsroman.
Die Medien und vor allem rechte Gruppierungen stürzen sich auf den Fall, verbreiten eigene Narrative und nutzen die stockenden Ermittlungen des BKA für ihre Propaganda. Es tauchen weitere Videos
auf, die mehr oder weniger direkt zur Lynchjustiz aufrufen. Auch die leitende Ermittlerin Yasira gerät wegen ihrer familiären Wurzeln im Libanon in die Schusslinie einiger Rassisten, die sich als
„Aktiver Heimatschutz“ formieren.
Während Yasira und ihr Kollege noch von Berlin in den idyllischen Harz fahren, um nach dem verschwundenen Mädchen zu fahnden, lässt die erste Leiche, vermeintlich einer der Täter, nicht lange auf
sich warten. Seine Hinrichtung natürlich in einem Video dokumentiert, das ebenfalls viral geht.
„Wie konnte alles in so kurzer Zeit eskalieren?“, lässt Kling seine Protagonistin grübeln, „Aber die Antwort ist ganz einfach. Es ist nicht in kurzer Zeit eskaliert. Im Gegenteil: Seit Jahrzehnten beobachten alle, wie die Gesellschaft immer mehr Risse bekommt, und keiner kittet sie. Da darf man sich nicht wundern, wenn sie schließlich zerbricht.“
Ja, es ist eine düstere Abrechnung mit der Gegenwart. Oder doch nur eine Bestandsaufnahme? Zum Glück hat sich Marc-Uwe Kling nach wie vor dem Humor nicht ganz abgewandt und so lässt er Yasira und
ihr Team oft zynische Witze reißen, die keinesfalls aufgesetzt wirken, sondern der Geschichte eine Leichtigkeit geben, sie in gewisser Weise erträglich macht.
Und wie sieht es mit dem Fall aus? Nun, irgendwann fragen sich die Ermittler, ob all die Unruhen und die Spirale der Gewalt, die das Video ausgelöst hat, nicht nur Begleiterscheinungen sind,
sondern sogar das eigentliche Motiv. Wollte jemand die Welt brennen sehen?
Nein, das ist an dieser Stelle kein Spoiler, denn eine weitere Wendung bringt zum Ende hin noch einmal ganz andere Aspekte ins Spiel, ebenfalls spannend, ebenfalls hoch aktuell, ebenfalls
bitterböse. Aber dazu wird an dieser Stelle nichts verraten, denn es lohnt sich in jedem Fall, diesen Roman zu lesen.
Vielleicht doch Mr. Nice Guy?
Alice Cooper und die Kraft des Rock
Als wir noch Schüler waren, verboten uns unsere Eltern die Musik von Alice Cooper. Meine zumindest; das ist wohl der Preis, wenn du in einem fundamentalistisch christlichen Elternhaus aufwächst. Spiele man seine Platten rückwärts ab, könne man satanische Botschaften empfangen, warnten sie, zudem sei das, was er auf der Bühne abziehe, widerwärtig und außerdem trinke er das Blut von Kindern im Keller einer New Yorker Pizzeria. Ach nee, letzteres war eine andere Verschwörungserzählung.
Nun ja, für uns gilt heute School’s out forever, längst sind wir selbst die Alten, doch immerhin gehört die Musik von Alice Cooper nicht mehr als Poison in den Giftschrank, er tritt sogar auf der
Northeimer Waldbühne auf, einer 7000 Menschen fassenden malerisch von alten Bäumen umgebenen Anlage hier in der südniedersächsischen Provinz. Nun gut, so sehr schocken wie in den 70ern, dass
soziale Netzwerke sich darüber ereifern, kann er vielleicht nicht mehr, dazu müsste er schon in Sachsen seine Solidarität mit der Ukraine bekennen wie sein drei Jahre älterer Kollege Rod Stewart.
Doch der 76-Jährige rockt die Bühnen auf seiner „Too close for comfort“-Tour noch immer. Dass er nicht mehr eighteen ist, fällt kaum auf. Vor einigen Monaten bei Bonnie Tyler in Berlin hatte ich
noch Angst, das Alter könne die Stimme in die Eclipse verbannt haben und somit die ganze Show beeinträchtigen. Auch Bonnie Tyler ist mittlerweile über 70, gut, sie hat bei manchen Passagen nicht
mehr ganz die Power von früher, doch mit neuen Arrangements und für mich spannenden Versionen der alten Stücke. Kurzum, für mich war sie auf der Bühne noch immer ein Hero (wer hier gendern mag,
soll es tun).

Alice Cooper war ja wie gesagt noch nie Mr Nice Guy, doch sein musikalisches Werk kenne ich längst nicht so gut, so dass ich mich mit deutlich weniger ängstlichen Gedanken auf das Konzert einlasse. Ich weiß immerhin, dass seine Bühnenshow wie schon vor über 50 Jahren von Horror-Showelementen durchzogen ist, allein das ist ein guter Grund.
Er heißt seine Fans nach wie vor in seinem Nightmare willkommen, in dem durchaus mal eine Puppe gequält, Paparazzi oder junge Frauen um die Ecke gebracht werden, Frankenstein seinen ganz großen
Auftritt hat und Cooper selbst in eine Zwangsjacke gepfercht wird, am Ende durch die Guillotine stirbt und aus der Hölle wieder aufersteht.
Das ist es also, wovor unsere Eltern uns früher gewarnt haben. (Ehrlich gesagt bin ich vor allem überrascht, wie viele Songs von Alice Cooper ich dann doch kenne.) Wovon sie fürchteten, wir
könnten es vielleicht nachmachen. Nun gut, heute schreibe ich Horrorgeschichten, doch bezweifle ich, dass daran Alice Cooper schuld ist und Rockmusik sicher nur zum Teil. Allerdings bin ich auch
fest davon überzeugt, dass es kein schlechter Einfluss ist.
Das, was Alice Cooper und seine Band da auf der Bühne abziehen, ist eine gut gemachte Show mit theatralischen und überwiegend mechanischen Effekten, die immer noch ziehen, immer noch typisch für
den bösen Rocker, als der er sich inszeniert, sind, aber dabei auch irgendwie liebenswert. The Man Behind the Mask ist eben ein exaltierter und leidenschaftlicher Entertainer, privat Sohn eines
Pastors, Familienvater und Großvater, kurz vor seiner goldenen Hochzeit. Und er ist nach wie vor ein großer Musiker.
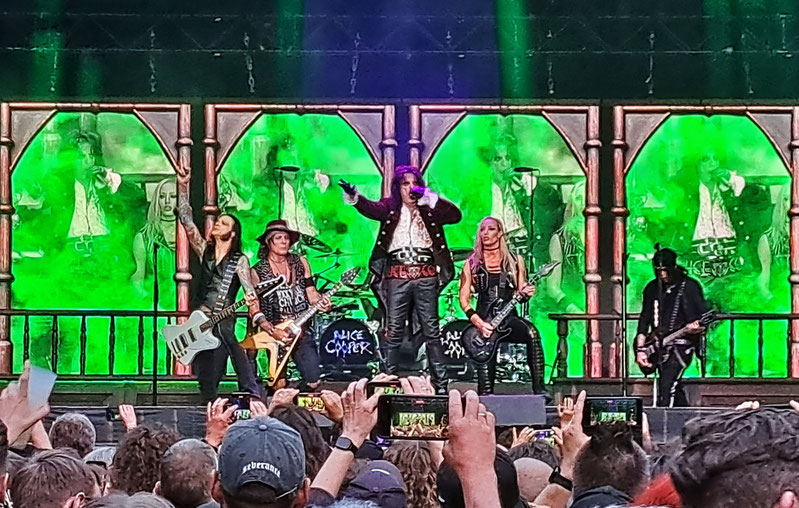
Daher schafft er es auch, dass jene, die seine Musik damals heimlich hörten, heute zum Teil ihre Kinder mit zur Show bringen und lässt seine eigenen Kinder in Rollen eben dieser schlüpfen. Rock ist die Musik, die Generationen verbindet, wenn Alice auf der Bühne „Hey“ ruft, brüllen ihm Tausende gemeinsam „Stoopid“ entgegen. Er zieht durch, ist nicht lost in America oder in Northeim, sondern bietet viel für Ohr und Auge.
Die großartige Kulisse der Waldbühne ist dafür im Grunde der perfekte Ort. Kein anonymes Stadion, sondern trotz voller Ränge irgendwie heimelig und der Kontrast zum Horror. Am Ende bringt der
Rockstar ein Medley aus „School’s Out“ und Pink Floyds „Another Brick in the Wall“ und läutet damit zum einen ganz klar die Sommerferien ein und macht zum anderen deutlich, wie zeitlos und
universell Rockmusik seit Jahrzehnten in unserer Gesellschaft und weltweit ist.
Seit Jahrzehnten bricht sie mit Normen, hinterfragt Strukturen, tut genau das, was Kunst immer schon getan hat und auch tun soll. Dass wir Menschen uns vor einer Bühne versammeln, um gemeinsam
Kultur zu erleben, ist auch ein Stück weit das, was uns als Menschheit ausmacht. Das würde nicht funktionieren, wenn Kunst immer nur Ideale abbildet, bin ich überzeugt, sie muss auch ein Stück
weit gesellschaftskritisch sein.
Ob ich Alice Cooper, Bonnie Tyler oder Rod Stewart heute noch als explizit gesellschaftskritisch bezeichnen würde, weiß ich nicht genau. Die Show, die ich zu sehen bekomme, ist aber auf jeden
Fall provokant und reißt mich musikalisch mit. So wie alle anderen hier. Mehrere tausend Menschen fühlen sich vor der Bühne vereint, spüren Gemeinschaft. Und das ist eben die andere Facette, die
Kultur auszeichnet.
Was wollen wir für Europa?
Geografisch nur wenige Meter voneinander entfernt, weltanschaulich so weit, dass es weiter kaum geht
„Es ist jetzt Schluss mit lustig, die rechten Parteien kommen und ich bin stolz, ein rechter Politiker zu sein, ich bin stolz, ein Rechtspopulist zu sein“, sagte Jens Kestner, Europakandidat der AfD, in Northeim. Zwei Tage vor der Europawahl hatte die AfD zur Abschlusskundgebung des Wahlkampfes mit Europa-Kandidaten, Bundestagsabgeordneten, Fraktionsvorsitzenden und Landesvorsitzenden auf dem Münsterplatz eingeladen.
„Wir werden Europa vom Kopf auf die Füße stellen, für ein Europa der Vaterländer und nicht für die Europaflagge. Wir brauchen diese EU nicht“, so Kestner weiter. Seine Parteikollegen wetterten
gegen die „Altparteien“, gegen die Regenbogenflagge, die über dem Platz gehisst ist, und auch gegen die Gegendemonstranten, die durch Absperrungen und Polizeikräfte getrennt ganz andere Ansichten
und Visionen für unsere Gesellschaft und für Europa vertreten.

Das Bündnis für soziale Gerechtigkeit und gegen Rechtsextremismus im Landkreis Northeim hatte zur „Meile der Demokratie“ aufgerufen, an der sich neben den demokratischen und pro-europäischen Parteien unter anderem die Omas gegen Rechts, die evangelische Jugend und zahlreiche andere Institutionen und Gruppierungen beteiligten. Eröffnet wurde sie von Bürgermeister Simon Hartmann, der sagte: „In Northeim leben über 4000 Menschen, die eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. Noch viel mehr Menschen haben Wurzeln in anderen Ländern. Sie sind unsere Nachbarn, unsere Kolleginnen und Kollegen, sie sind wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft, die auf der Idee eines freien und liberalen Europas basiert.“ Dann fügte er noch hinzu: „Wir stehen zusammen und wir passen gut aufeinander auf.“
120 bis 130 AfD-Anhänger auf der einen und 500 Gegendemonstranten auf der anderen Seite, so die Zahlen der Polizei. Geografisch nur wenige Meter voneinander entfernt, weltanschaulich so weit,
dass es weiter kaum geht. Zu Zwischenfällen kam es nicht, so sagte es mir ein Polizeisprecher am Abend, wenigstens das.
Ist ja leider nicht mehr selbstverständlich, wie wir in diesem Wahlkampf besonders schmerzlich gelernt haben. In Mannheim musste ein Polizist sterben, weil er in seinem Dienst einen
islamistischen Extremisten nach einer Messerattacke auf einen islamfeindlichen Hetzer fixieren wollte. In Göttingen wurde die grüne Politikerin Marie Kollenrott bei einer Wahlkampfveranstaltung
angegriffen und verletzt, so wie zahlreiche weitere Wahlkämpfer*innen in anderen Städten auch.

Der Ton in unserer Gesellschaft wird schärfer, die Bereitschaft zu Gewalt offenbar geringer. Zudem scheint es, als müssten wir uns zwischen einem freien und liberalen Europa und einem Europa der Vaterländer entscheiden. Und wenn wir uns für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft entscheiden, müssen wir sie offenbar verteidigen gegen diejenigen, die so viele Werte ablehnen, die dieses Europa sich in den letzten Jahrzehnten mühsam erkämpft hat.
Wir leben in einer Gesellschaft, die uns Freiheiten lässt wie nie zuvor in der Geschichte. Minderheiten werden geschützt, auch wenn einige aus einer konservativen und rechten Bubble das wohl als
Bedrohung empfinden. Dieses Europa könnte sich auf den Weg in eine moderne, globalisierte Zukunft machen, in der der einzelne Mensch und nicht seine Herkunft zählt.
Noch dazu stehen wir mit dem Klimawandel und einer von Standorten losgelösten Wirtschaft vor Herausforderungen, die uns alle als Weltbürger, als Menschen betreffen. Warum also pochen so viele
immer noch auf Nationalismus, auf eine Welt von gestern, die im Grunde jetzt schon vollkommen überholt ist? Warum ist jemand stolz darauf, Populist zu sein?
Vielleicht bin ich ja zu naiv, vielleicht zu linksgrünversifft, vielleicht zu christlich geprägt, so dass ich alle Menschen als Kinder Gottes und uns als eine Einheit sehe. Aber mir fehlt
jegliches Verständnis für die Weltanschauungen der Rechten und Rechtsextremen. Mir ist es egal, ob mein Gegenüber deutsch ist oder was auch immer, viel wichtiger ist mir, das er mein Nachbar,
mein Kollege, mein Freund ist. Wenn ich mit jemandem reden, lachen, vielleicht sogar weinen kann, dann ist doch alles andere egal. Lasst uns doch einfach nur Menschen sein.
Deutschland im 75. Jahr des Grundgesetzes
Jugendliche, die Demokratie gestalten, und Rich Kids, für die nur Papas Kohle zählt
75 Jahre Grundgesetz waren der Anlass für die Bundestagsabgeordnete Frauke Heiligenstadt, im evangelischen Jugendhaus in Osterode mit Jugendlichen über unsere am 23. Mai 1949 in Kraft getretene Verfassung zu diskutieren. Der Verein Demokrateatime, in dem Jugendliche sich mit Demokratiebildung vor Ort auseinandersetzen, bzw. ganz konkret der Vorsitzende Alexander Fröhlich, der auch in der evangelischen Jugend aktiv ist, hatte sie eingeladen.
Alexander war es auch, der die anderen Jugendlichen aus unterschiedlichen Orten im Harzer Land zunächst begrüßte und dazu anleitete erst einmal in Kleingruppen über verschiedene Aspekte des
Grundgesetzes zu diskutieren. Was sind die Errungenschaften? Wo gibt es aus Sicht der Jugendlichen Reformbedarf? Wie lässt sich eine wehrhafte Demokratie gestalten?
Die Bundestagsabgeordnete hatte zunächst noch dem Staatsakt in Berlin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beigewohnt und dann bei der Kundgebung auf dem Osteroder Kornmarkt einige Worte
gesagt. Auch den Jugendlichen im evangelischen Jugendhaus berichtete sie vom Staatsakt. Es seien die Anfänge unserer Bundesrepublik gelobt worden, erzählte sie, Steinmeier habe hervorgehoben,
dass unser Grundgesetz Frieden und Freiheit in unserem Land garantiere. Dennoch habe er dazu ermahnt, die Demokratie am Leben zu erhalten, unter anderem durch ehrenamtliches Engagement in
karitativen Einrichtungen und der Kirche.

Anschließend stellte sich Frauke Heiligenstadt den Fragen der Kleingruppen, diskutierte mit ihnen vieles, was durchaus auch über die anfänglichen Fragestellungen hinausging. Als „politisches Speeddating“ hatte Alexander Fröhlich diese Planung des Abends bezeichnet und es funktionierte ausgesprochen gut. Immer wieder scharten sich einige um die Politikerin, um mit ihr ziemlich intensiv auch über Themen wie Abtreibung, die Spaltung unserer Gesellschaft, die Schuldenbremse oder auch ein Recht auf Suizid zu diskutieren.
Zu Letzterem erläuterte Frauke Heiligenstadt beispielsweise, dass im Bundestag drei verschiedene Anträge zur Abstimmung gestanden hätten, von denen keiner eine Mehrheit bekam. „Wenn du so einen
Schiffbruch erleidest, ist bei einem Thema auf absehbare Zeit nichts mehr zu machen“, beschrieb sie die demokratischen Prozesse im Parlament.
Der Abend endete wie für den jungen Verein üblich nicht mit Demokratie, sondern sozusagen mit Dönerkratie, also gemeinsamem Essen, bei dem viele Gespräche noch ganz locker vertieft wurden. Über
das Grundgesetz, über Politik, aber auch über Gott und die Welt.

Diesen Pressetext habe ich heute rausgeschickt und war wirklich begeistert von den Jugendlichen, die viel Wissen und Interesse mitbrachten, sich gut auf das Thema Grundgesetz vorbereitet hatten und in lockerer Atmosphäre sehr sachlich und in die Tiefe gehend mit der Bundestagsabgeordneten diskutierten. Etwas enttäuscht war ich über die relativ geringe Teilnahme an der Kundgebung ein paar Straßen weiter. Dort waren vor allem die Omas gegen Rechts vor Ort, denen Frauke Heiligenstadt übrigens zum Aachener Friedenspreis gratulierte. Ja, auch mich hat diese Nachricht vor ein paar Tagen echt gefreut. Weniger gefreut hat mich wie gesagt, dass so weniger zur Kundgebung kamen. Für 75 Jahre Grundgesetz kann man doch auch mal eine halbe Stunde später mit dem Grillen anfangen, oder nicht?
Noch entsetzter war ich heute allerdings als ich bei Twitter reinguckte und sah, was Jugendliche andernorts so treiben. Ja, ich meine natürlich die Rich Kids auf Sylt, die dort, wie Dunja Hayali
es so treffend ausdrückte "mit Hitlerbärtchen und Schampus, aber ohne Ausländer“ feierten. Für sie war
dieses Verhalten offenbar gesellschaftsfähig genug, um das Video dazu anfangs erst einmal hochzuladen.
Das also ist Deutschland im 75. Jahr des Grundgesetzes. Auf der einen Seite Jugendliche, meist noch Schülerinnen und Schüler, die sich intensiv mit unserer Geschichte und Politik auseinandersetzen, weil sie die Demokratie auch für ihre Generation erhalten wollen, auf der anderen Seite solche, denen all diese Werte egal sind, weil für sie vermutlich nur Papas Kohle zählt, die sie einmal erben werden. Und im Netz gibt es tatsächlich einige, die dieses Verhalten auch noch entschuldigen, als geschmacklos herunterspielen und dann mit Whataboutism kommen. Da läuft es mir kalt den Rücken runter.
Allerdings habe ich vorhin dann in der taz auch gelesen, dass zwei der im Video auftauchenden Partypeople schon jetzt die Konsequenzen zu spüren bekommen. Einer, der bei einer PR- und Marketingfirma arbeitete, sei fristlos entlassen, einer anderen, die bei einer Influencerin angestellt war, sei ebenfalls umgehend gekündigt worden. Immerhin. Trotzdem finde ich es (wieder einmal) erschreckend, wie gespalten unsere Gesellschaft doch inzwischen ist.
Wie geht es weiter mit Europa?
Podiumsdiskussion mit Vertretern der demokratischen Parteien zur Europawahl
Mehr europäische und weniger nationale Entscheidungen fordert Kai Tegthoff, Kandidat für die Europawahl von Volt. Nein, wir haben das demokratischste EU-Parlament, das wir je hatten, widerspricht der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Jan-Christoph Oetjen (FDP). Die Arbeit, die die EU leistet, sei gut, es könne nur um einige Verbessrungen gehen, meint auch Bernd Lange (SPD), Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament.
Vor zwei Tagen durfte ich eine Podiumsdiskussion zur Europawahl am 9. Juni besuchen, sehr hochkarätig besetzt und organisiert und moderiert von Jugendlichen. Bei uns hat sich im vergangenen Jahr
der Verein Demokrateatime gegründet, der es sich zur Aufgabe macht, Jugendbeteiligung in der Region zu stärken und über Demokratie zu informieren. Dafür wurde er schon im Bundeswettbewerb
Demokratisch Handeln ausgezeichnet.
Den Vorsitzenden, Alex, der gerade sein Abi gemacht hat, lernte ich schon bei anderen Veranstaltungen kennen und schätzen, so dass ich natürlich gerne auch zu dieser Diskussionsrunde ging. Zu den
Gästen gehörten wie oben erwähnt der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Jan-Christoph Oetjen (FDP, der Europaabgeordnete Bernd Lange (SPD) und Kai Tegthoff (Volt) sowie weitertin
Dirk-Claas Ullrich (Bündnis 90/die Grünen), Johanna Brauer (Die Linke) und Alexander Böger (CDU). Es ging um langfristige Ziele der Europäischen Union, um Sicherheit für Europa und auch um
Migration.

Nun stellen Alex und sein Team natürlich nicht alles ganz allein auf die Bühne, sein Gymnasium, wo die Veranstaltung stattfand, ist Europaschule und bietet schon lange Projekte etc. zum Thema Europa und EU-Politik an. Dennoch ist es ja nicht selbstverständlich, dass das auch fruchtet, so dass ich nach wie vor vom Engagement der Jugendlichen begeistert bin und außerdem auch, wie routiniert sie die Talkrunde moderierten.
So kitzelten sie zunächst einmal heraus, dass sich alle Kandidat*innen ein Zusammenwachsen und letztlich einen europäischen Bundesstaat, also die United States of Europe wünschen. Manche sofort,
andere eher langfristig, aber das gemeinsame Ziel für Europa ist damit auf jeden Fall eindeutig.
In Bezug auf den Krieg in der Ukraine wurde über gemeinsame Waffenlieferungen und auch eine gemeinsame Armee diskutiert. „Wir müssen in die Verteidigung der EU investieren“, forderte Bernd Lange,
wohingegen Johanna Brauer betonte, dass Krieg nie eine Lösung sei, es müsse also auch weiterhin mit Putin verhandelt werden. „Putin könnte diesen Krieg sofort beenden“, widersprach Jan-Christoph
Oetjen.

Ganz aktuell hat die EU einer Asylreform zugestimmt, dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS), einem umfassenden Gesetzespaket zur Reduzierung irregulärer Migration. In diesem Thema gingen die Meinungen dann weit auseinander. So konstatierte Dirk-Claas Ullrich: „Das, was gerade passiert ist, ist der größte Rechtsruck im Europäischen Parlament, den wir jemals erlebt haben.“
Nein, GEAS sei einen Versuch wert, widersprach Alexander Böger, es gab schließlich Handlungsbedarf an den europäischen Außengrenzen. Es müsse sich etwas ändern, da nach wie vor Menschen im
Mittelmeer ertrinken, pflichtete ihm Jan-Christoph Oetjen bei. Johanna Brauer allerdings bezeichnete das Gesetzespaket als „menschenverachtend“, wenn der Weg über das Mittelmeer für Flüchtende
eingeschränkt werde, müssen man andere Fluchtrouten öffnen.
Asyl und Arbeitsmigration seien nicht zu vermischen, mahnte Kai Tegthoff. Lager für Geflüchtete an europäischen Außengrenzen sind für ihn unmenschlich, für Arbeitsmigranten müssten deutliche
Anreize geschaffen werden, und zwar für ganz Europa. Bernd Lange betonte noch, dass eine Verbringung in Drittstaaten, so wie es in Großbritannien aktuell gemacht werde, nach europäischem Recht
unmöglich sei, worauf Alexander Böger widersprach und diese Rechtsauffassung anzweifelte.

Im Anschluss gab es noch Raum für einige Nachfragen der Schüler*innen, auf die ich hier kaum eingehen kann, außerdem möchte ich mich mit meiner eigenen Meinung zu manchen Positionen zurückhalten. Da ich auch schon ähnliche Podiumsdiskussionen, auch an Schulen, mit Wahlkandidat*innen verschiedener Parteien moderiert habe, weiß ich eben, wie anstrengend das mitunter werden kann – nicht der Schüler wegen, sondern weil manche Politiker schwer zu bremsen sind oder auch gerne mal in Populismus verfallen.
Daher gilt Alex und seinem Team mein größter Respekt, zum einen, weil ich in dem Alter längst nicht so politisch engagiert war und es bemerkenswert finde, zum anderen, weil sie ihre Sache auch
wirklich gut machen. Sie laden immer wieder Politikvertreter ein, um nachzufragen, mit ihnen zu diskutieren und ihnen damit zu zeigen, wer die Wähler von morgen sind. Das kommt mir persönlich oft
viel zu kurz, weil es auf den großen Bühnen und in den großen Medien oft nur um die Lautesten geht.
Diese Diskussion zeigte, wie inhaltlich kontrovers Politik und auch Demokratie sein kann, aber auch wie konstruktiv und informativ, wenn nicht Populisten den Rahmen der Sachlichkeit sprengen.
Meiner Meinung nach war es eine gute Entscheidung, nur die wichtigen demokratischen Parteien einzuladen, eine Entscheidung, an der sich große Fernsehtalkshows ein Beispiel nehmen sollten.
Leitkultur?
Im multikulturellen Rössl
Bei „Himmelblau“ denken einige Jüngere vielleicht an Jay von PietSmiet und ein gewisses virales Video, nur wenige der Älteren kommen wahrscheinlich sofort auf „Die ganze Welt ist himmelblau“ aus dem Singspiel „Im weißen Rössl“ von 1930 oder die Verfilmung mit Peter Alexander aus 1960. Doch genau dieses Stück haben sich die stillen Hunde, die Göttinger Schauspieler Christoph Huber und Stefan Dehler, mit dem interkulturellen Bürgertheater aus Moringen vorgenommen.
Allzu ernst sollten die Zuschauer*innen all das bei der Premiere in der KGS Moringen aber besser nicht nehmen. Zwar ging es unverkennbar um die berühmte Herberge im Österreichischen Salzkammergut
und auch die Lieder stammten aus dem Lustspiel, doch einige Modernisierungen und manches Augenzwinkern gab es freilich - darüber bin ich sehr froh, denn es wäre sonst niemals das, was ich mir
freiwillig angucken würde.
Allem voran ist das, was diese Aufführung ausmacht, die Besetzung selbst. Die nämlich ist beim Bürgertheater mitnichten typisch österreichisch oder auch typisch deutsch, sondern international und
bunt - also im besten progressiven Sinne dann doch wieder typisch deutsch. Das Bürgertheater ist im Zuge der großen „Flüchtlingswellen“ als Integrationsprojekt entstanden, wurde von
Ehrenamtlichen angestoßen, damit diejenigen, die zu uns kamen und kaum Kontakte hatten, und diejenigen, die hier möglicherweise sogar Sorge vor allzu großen Veränderungen hatten oder eben
Willkommenskultur aktiv leben wollten, einander kennenlernen konnten.

Mit dem ersten Bürgertheaterprojekt wurde im Herbst 2016 begonnen, im Frühjahr 2017 hatte dann „Ein Sommernachtstraum“ – sehr frei nach Shakespeare und den noch recht überschaubaren Deutschkenntnissen einiger Darsteller angepasst – seine Premiere. Es folgten „Faust“, „Romeo und Julia“, „Der Diener zweier Herren“, „Der schönste Tag“ (als Freiluftaufführung im Moringer Stadtpark 2021 und 2022) sowie „Der Sturm“. Gefördert wird „Himmelblau“ jetzt vom Bundesprogramm „Demokratie Leben!“, von der Kultur- und Denkmalstiftung Landkreis Northeim, der AKB Stiftung, der Lotto-Sport-Stiftung sowie dem Landschaftsverband Südniedersachsen.
Einige aus dem Ensemble sind von Beginn an dabei, andere kamen hinzu, auf jeden Fall kommt „Himmelblau“ durchaus textlastig und mit einem Fokus auf Wortwitze daher. „Ein Drittel der Mitwirkenden
waren immer Jugendliche, knapp die Hälte der gesamten Gruppe Menschen mit einer aktuellen Migrationsgeschichte“, sagt Stefan Dehler. Das wirklich extrem gemischte Team hat sich also eingespielt,
ist zusammengewachsen, und nicht nur das, das Bürgertheater ist auch zu einer Institution in Moringen geworden, wie das große Publikum und insgesamt vier Aufführungen beweisen.

Absolut zu Recht. Schauspielerisch wie musikalisch muss sich die Aufführung absolut nicht verstecken, die internationale Besetzung hat dazu ihren eigenen Reiz und zieht ja auch ebenso multikulturelles Publikum in dieses Stück, das vermutlich den wenigsten noch bekannt ist. Es ist somit ein deutliches Zeichen, wie Integration gelingt, nämlich nur durch persönlichen Kontakt, durch Austausch, durch gemeinsame Projekte und eben am Ende auch durch gemeinsamen Spaß an etwas.
Nach „Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“, „Was kann der Sigismund dafür, daß er so schön ist?“ und etlichen amourösen Irrungen und Wirrungen fiel an diesem Premierenabend der letzte
Vorhang. Der Applaus hielt noch lange an und die Schauspieler*innen mischten sich glücklich unter ihr Publikum.
Für mich selbst endete der Abend als Pressevertreter hier, ich quatschte noch kurz mit den stillen Hunden, die ja auch schon bei unserem Mordsharz-Festival mit dabei waren, dann machte ich mich mit dem Kopf voller Gedanken auf den Heimweg. Im Auto kamen mir viele Erinnerungen an die erste Zeit mit F. und D. und ihren Kindern. Wie sie unsere deutsche Kultur kennenlernen wollten.

Sie hatten sich von Anfang an auf vieles eingelassen, wohin ich sie mitschleppte. Einmal auf einer längeren Autofahrt hatte D. eine Andrea Berg-CD eingelegt, um mir eine Freude zu machen. Ja, er konnte ja nicht ahnen, dass ich seine syrische Musik, die sonst oft lief, viel lieber mag als deutschen Schlager. Aber er erzählte so stolz davon, wie er durch die Songtexte auf dem Weg zur Arbeit noch versuche besser Deutsch zu lernen, dass ich doch davon absah, die CD aus dem Fenster zu werfen.
Dieses Theaterprojekt sorgte bei allen, die teilnahmen, vermutlich für ganz ähnliche Erinnerungen. Für gegenseitiges Verständnis, für Respekt und für Zusammenwachsen. Das ist es nun mal, was
unsere Gesellschaft so dringend braucht. Persönliche Kontakte und Freundschaften und daraus resultierend irgendwann eine gemeinsame Kultur, die für nostalgische Gefühle sorgt.
Diese Gedanken versöhnten mich an diesem Abend mit einem Stück, das ich mir freiwillig vermutlich nie angesehen hätte, mit Musik, die absolut nicht meine ist. Weil ich die Hoffnung habe, dass
solche Projekte dafür stehen, wie wir miteinander umgehen, für eine Weltoffenheit und für Vielfalt. Und eben auch dafür, dass das, was einige als „Leitkultur“ bezeichnen, bunt durchmischt und
endlich aus dem verklärten Gestern geholt wird.
Torten gegen Populismus
Buchtipp: „Was Rechtspopulisten fordern“ von Katja Berlin
Seit einigen Jahren erleben wir einen politischen wie gesellschaftlichen Rechtsruck. Populisten verbreiten einfache Antworten auf komplexe Probleme sowie Fake News und Hetze. Bis heute ist es weder der Politik noch den Medien gelungen, dem angemessen zu begegnen, da viele Anhänger sich auch von Fakten nicht mehr überzeugen lassen.
Was aber wirksam sein kann, ist zum einen ein Aufzeigen der populistischen Methoden, wodurch schnell klar wird, wie absurd vieles eigentlich ist, und zum anderen Humor. Ja, Humor. Ein gesundes
Verhältnis aus Zynismus und Gelassenheit, weil allzu große Empörung ja leider auch nichts bringt.
Genau diese Mischung gelingt Katja Berlin in ihren Kolumnen, auf Social Media und in ihren Büchern. „Was Rechtspopulisten fordern“ lautet der Titel ihrer neuesten Veröffentlichung, einem Buch,
das nicht mehr als unterschiedliche Diagramme präsentiert.

Es sind im Grunde kleine Grafiken zu einer präzisen Fragestellung, die nicht mit wirklichen Statistiken, aber mit leider offensichtlichen Wahrheiten arbeiten. So beispielsweise ein Tortendiagramm zu: „Wann wir hören, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr gibt.“ Darunter ein winziges Tortensegment, dem die Aussage „Wenn Menschen nach feministischen Äußerungen bedroht werden“ zugeordnet ist, ein ebenso winziges Segment zu: „Wenn Menschen nach antifaschistischen Äußerungen beleidigt werden“ und der gesamte große Rest zu: „Wenn Menschen nach diskriminierenden Äußerungen kritisiert werden.“
Ein klares, eingängiges Bild, über das es sich aber nachzudenken und auch zu diskutieren lohnt. Eben, weil es sehr explizit deutlich macht, wie Populismus funktioniert, wie Diskurse verschoben
werden und an welchen immer wiederkehrenden Parolen sich Populisten festhalten.
Ein weiteres Bild zeigt einfach nur einen blauen Kreis. Darüber die Überschrift: „Welchen Repressalien Rechtspopulisten in der ‚linken Meinungsvorherrschaft‘ Deutschlands ausgesetzt sind. Die
Farbe Orange stehe für „Sie dürfen nicht in den Bundestag einziehen“, grün für „Ihre Bücher dürfen keine Bestseller werden“, gelb für „Sie werden nicht in Talkshows eingeladen“ und blau steht für
„Sie werden kritisiert“. Wie gesagt: nur ein blauer Kreis.

Diese Diagramme sind pointiert, sie sind sicher auch in Teilen überzogen, doch vor allem drücken sie ohne viele Worte so vieles aus, was in unseren politischen wie gesellschaftlichen Diskussionen schief läuft und eben ganz gezielt in Schieflage gebracht wird.
Katja Berlin studierte Politikwissenschaft und Medienberatung und schreibt unter anderem für das Handelsblatt, die Berliner Zeitung und die Zeit. Sie veröffentlichte als alleinige Autorin sowie
mit Co-Autoren mehrere Bücher und schafft es, komplexe und vielschichtige Aussagen auch für die TikTok-Generation auf den Punkt zu bringen.
„Was Rechtspopulisten fordern“ ist ein entlarvendes Buch, ohne dabei eine akademische Auseinandersetzung mit dem Thema zu verlangen. Es legt den Finger in so manche Wunde und macht vieles auf
einen Blick deutlich, woran andere in langen Erklärungen gescheitert sind. Zu gerne würde ich täglich die Torte des Tages oder sowas von ihr posten, doch dafür gibt es ja ihre Social Media-Kanäle
und eben dieses Buch.
Übrigens: Jeden Sonntag gibt es einen Buchtipp von mir auf meinem Instagram- sowie meinem Twitter-Kanal.
Lebensmittelretter für einen Tag
Auf Tour für die Tafel
Auf Tour für die Tafel. Lebensmittel vor der Mülltonne retten. Das ist heute meine Mission. Morgens um 7 Uhr geht es in Osterode los, Frank nimmt mich mit. Er selbst fährt seit Jahren für die Tafel, holt mehrmals pro Woche Waren, die nicht verkauft wurden, bei Supermärkten in der Region ab.
Er hat seine feste Tour, erklärt er mir, weiß genau, ab wann er wo vorfahren kann, um die Kisten abzuholen und in den Lkw zu laden. Für mich ist alles neu, bisher wusste ich nur theoretisch,
welche Logistik überhaupt nötig ist, damit der gemeinnützige Verein die etwa 500 Kund*innen der Ausgabestellen in Osterode sowie in Bad Grund, Bad Lauterberg, Barbis, Clausthal-Zellerfeld,
Duderstadt, Gieboldehausen, Gittelde, Herzberg, Scharzfeld und Wulften versorgen kann.
Unsere Tour beginnt in Herzberg, ich gehe auf Franks Anweisung in den ersten Markt hinein, melde mich beim Personal und gehe dann gleich durch ins Lager, wo schon einige Kisten auf ihre Abholung
warten. Ehrlich gesagt muss ich ein wenig suchen, um den Knopf für das große Tor der Laderampe zu finden, dort nimmt Frank die Kisten in Empfang.

Allerdings werden sie nicht einfach eingeladen, sondern umgepackt und dabei durchsortiert. Zum einen müssen es alles gleiche Kisten sein, damit sie in Osterode richtig gelagert werden können, zum anderen werden nur die Lebensmittel mitgenommen, die auch noch weitergegeben werden können. Es ist ein Samstag, die Waren müssen also bis Montag gelagert werden, bevor sie dann an die Ausgabestellen geliefert werden. Abgepackter Salat beispielsweise wird nicht mitgenommen, da der übers Wochenende zu anfällig ist.
Zielsicher greife ich gleich einen Joghurtbecher mit einem Riss, aus dem der Inhalt quillt, auch der muss natürlich entsorgt werden. Schnell die Hände abwischen und weiterpacken. Es ist
ungewohnt, mir fehlt noch der Blick dafür, was aussortiert wird, aber es ist faszinierend, wie routiniert Frank das macht.
Beim nächsten Markt geht es für uns gleich nach hinten an die Laderampe, hier stehen die vorsortierten Kisten schon bereit. Unsere Tour führt über Osterode nach Teichhütte. Kevin Stranski reicht
uns hier die Kisten sogar an. Wie viele andere Mitarbeitende in den Märkten weiß er um die Bedeutung der Tafel für viele Menschen und schätzt ebenso den Gedanken der Nachhaltigkeit.
Ja, es wäre schade um das Obst und Gemüse, Brot, Milchprodukte, Süßigkeiten und vieles andere, was sonst weggeworfen werden müsste. Und natürlich wissen die Mitarbeitenden in den Märkten auch die
eingespielten Abläufe zu schätzen, dass sie die Waren oft nur hinstellen müssen, keine zusätzliche Arbeit dadurch haben.

Zugegeben, mir müssen sie an diesem Tag oft die Wege weisen, Frank hingegen fährt an einigen Märkten nur vorbei und sieht schon von der Straße aus, ob dort Kisten stehen, ob sie heute etwas für uns haben. Unsere Tour führt über Wulften nach Gieboldehausen, zu insgesamt 17 Märkten. Zeit für eine Pause oder ein Schwätzchen bleibt nicht, alles ist eng getaktet, echte Arbeit eben.
Zurück in Osterode müssen die Kisten schließlich noch aus dem Fahrzeug ins Kühlhaus gestapelt werden. 46 Kisten sind es insgesamt, alle randvoll mit Lebensmitteln für Menschen, die sich sonst
eine ausgewogene Ernährung nur schwer leisten können. Mittlerweile ist Mittagszeit, mehr noch als meinen Magen spüre ich aber meinen Rücken. Da ich sonst ja meist nur am Schreibtisch sitze, ist
die Arbeit doch ungewohnt.
Frank bewundere ich aber nicht deswegen, sondern weil er wie viele andere seinen Dienst für Menschen tut, die auf Hilfe angewiesen sind. Weil er tatkräftig hilft, die Schere zwischen Arm und
Reich in unserer Gesellschaft nicht noch weiter auseinanderklaffen zu lassen. Weil er freiwillig eine Aufgabe übernimmt, die es meiner Meinung nach eigentlich in einem reichen Land wie
Deutschland gar nicht geben dürfte. Doch zum Glück gibt es Menschen wie ihn, zum Glück gibt es die Tafel und ich habe heute noch einmal mehr Respekt für all jene bekommen, die sich hier für
Menschen und auch für die Schattenseiten des Konsums engagieren.
Ist Demokratie zu woke?
Leipziger Buchmesse sorgte für scharfe Kritik aus rechten Bubbles
Die Leipziger Buchmesse ist mit 283 000 Besuchern auch in diesem Jahr wieder eines der größten Events für alle, die sich für Bücher interessieren. Dabei ist gerade diese Veranstaltung mit der angegliederten Manga-Comic-Con ein Schnittpunkt für sämtliche literarischen Genres und alle, die sich in diesem popkulturellen Kosmos wohlfühlen.
Letztlich ist das für mich auch ein Grund, jedes Jahr wieder nach Leipzig zu fahren: auf der emotionalen Ebene der bunte Trubel zwischen Büchern, Cosplay und vielem, was ich so mag, und auf einer
übergeordneten eben auch dieser breit gefasste Literaturbegriff. Literatur ist hier nicht nur das, was wir damals im Deutschunterricht gelernt haben (in der Uni waren ja manchen Professoren
selbst Krimis zu platt, um sie literaturwissenschaftlich ernst zu nehmen), sondern umfasst eben auch Bereiche wie Comic, Manga und große Teile der Popkultur.
Genau das ist nun mal auch meine Auffassung von Literatur, also eine inklusive, die alles umfasst, was von literarischen Erzählstrukturen geprägt ist, oder anders gesagt, alles, was damit zu tun
hat, gute Geschichten zu erzählen. Da fallen dann auch Filme, Hörspiele und Videospiele rein, die letztlich ja auch nur akustische und optische Komponenten hinzufügen. Und gerade Cosplay ist
meiner Ansicht nach aus eine Möglichkeit, sich mit literarischen Figuren auseinanderzusetzen, sie somit am Leben zu erhalten.

Diesen inklusiven Aspekt hat die Buchmesse bzw. der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in diesem Jahr auch ganz deutlich gemacht. #DemokratieWählenJetzt lautete die Initiative, die auf demokratische Grundwerte wie die Menschenwürde, Freiheit und Toleranz hinweisen sollte.
Da die Literatur schon immer (größtenteils) für Offenheit, für Weiterentwicklung, für eine progressive Gesellschaft steht, ist es eigentlich nur logisch und konsequent. In den Zeiten, in denen
wir leben, aber leider nicht für alle. Die Eröffnungsveranstaltung und damit die Initiative wurden von manchen Bubbles scharf kritisiert, natürlich vor allem im Netz.
So kommentierte die Welt-Journalistin Anna Schneider den Post des Börsenvereins mit „Fürchte, so mancher Grüne glaubt wirklich, er repräsentiere ‚Die Demokratie‘, auweh“. Ja, Frau Kollegin,
Grüne, Autor*innen, Journalist*innen, Kulturschaffende, Leser*innen und überhaupt die Mehrheit der Bürger*innen glaubt das. Dass Sie sich daran stören, ist prinzipiell Ihre Sache, lässt aber doch
einige Rückschlüsse zu.

Auch Jan Fleischhauer, einst Spiegel, jetzt Focus, ließ sich zu einer Äußerung hinreißen, eine, die mich ehrlich gesagt schockierte. „Man kann auch aus ästhetischen Gründen zum Demokratiefeind werde. Bin kurz davor“, schrieb er zu jenem Bild der Eröffnungsveranstaltung, auf dem alle im Saal Schilder mit „Demokratie wählen. Jetzt.“ hochhalten.
Sorry, aber aus ästhetischen Gründen zum Demokratiefeind werden, das ist sicher (hoffentlich) satirisch gemeint, aber alles andere als lustig. Wir sind also an einem Punkt angekommen, an dem es
manchen Menschen zu woke ist, wenn andere sich zur Demokratie bekennen. Das macht mir wirklich Angst.

Klar, die Gräben in unserer Gesellschaft sind nahezu unüberwindlich, deshalb schreibe ich ja diesen Blog. Klar, es gibt unterschiedliche Auffassungen zu Politik, zu Moral und Ethik und und und. Und mir ist auch bewusst, dass gewissen rechten Bubbles nichts zu blöd ist, um gegen die Ampel, gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen „die da oben“ und das System zu hetzen.
Aber dass der Ton inzwischen so scharf geworden ist, dass selbst Journalist*innen, denen ich eigentlich ein gewisses Maß an Weitsicht und auch Zurückhaltung zutraue, so eindeutig auf den Zug des
Populismus aufspringen, so eindeutig Hetze betreiben, das ist eine Entwicklung, die mehr als bedenklich ist. Irgendwie möchte ich ihnen ja zugutehalten, dass sie sich nur als scharfe Mahner
sehen, doch ihnen müsste auf jeden Fall bewusst sein, wo und wie ihre Aussagen verfangen.
Vielleicht ist es daher gerade jetzt wichtig, dass alle anderen zusammenstehen, dass wir uns auf die Bildung unserer jungen Generationen (und nicht nur der) fokussieren, dass die Literatur- und
alle Kulturschaffenden noch lauter ihre Stimme erheben, dass wir als Mehrheit der Gesellschaft ganz unabhängig von Parteien und „denen da oben“ klarmachen, dass wir auch in Zukunft in einer
Demokratie leben wollen. Weil alles andere nämlich erwiesenermaßen Scheiße ist.
Wir sind es, die die Zukunft gestalten
SchulKinoWochen zum Thema Demokratie
Jonas Kaufmann reiste an die polnisch-ukrainische Grenze, um dort Flüchtlinge zu unterstützen. Dadurch lernte der 20-jährige Schauspieler Menschen seiner Generation kennen, die doch in ganz anderen Welten zu leben scheinen, und er lernte viel über sich selbst und das Leben. Er machte einen Film darüber, über den er bei den Schulkinowochen in Herzberg zum Thema Demokratie sagte, er habe ihn nie als politischen Film gesehen, doch durch die Diskussionen mit Schülern über sein Regiedebüt habe er festgestellt, dass Demokratie von Menschen gestaltet wird.
Die SchulKinoWochen Niedersachsen sollen Medienkompetenz von Jugendlichen stärken. Es geht um künstlerische Auseinandersetzung, aber auch um gesellschaftliche Aspekte von Filmen. In der Kinowelt
Central-Lichtspiele in Herzberg waren am vergangenen Mittwoch Schüler*innen der BBS 1 Osterode, des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg, des Pädagogiums Bad Sachsa, der Kooperativen
Gesamtschule Bad Lauterberg und der Oberschule Hattorf aus verschiedenen Jahrgängen zu Gast, die zwischen mehreren Filmen wählen konnten.

Einer davon eben „Der Kern, der dich zusammenhält“ von Jonas Kaufmann, ein anderer „Warum ich hier bin“ von Regisseur Wolfgang Latteyer, der ebenfalls zu Gast war, oder unter anderem auch „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“, ein Spielfilm mit Meltem Kaptan und Alexander Scheer über den Fall des nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 in Guantanamo inhaftierten Murat Kurnaz oder vielmehr über seine Mutter und ihre Bemühungen, den Sohn aus den menschenunwürdigen Haftbedingungen zu befreien.
Rabiye Kurnaz schaltete seinerzeit den Anwalt Bernhard Docke ein, der ebenfalls in Herzberg zu Gast war. Wenn der Film selbst noch zwischen Tragik und (Galgen-)Humor schwankt, so erzählte
Rechtsanwalt Docke sehr ernüchternd über die Verhältnisse in Guantanamo, die nichts mehr mit einem Rechtsstaat oder Menschenrechten zu tun haben und auch über die unrühmliche Rolle der deutschen
Regierung in diesem Fall.
Deutschland nämlich wollte Murat Kurnaz nicht zurückholen, da er neben der deutschen auch eine türkische Staatsbürgerschaft habe und man somit nicht zuständig sei. Maßgeblich involviert in die
Verhandlungen damals seien der spätere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, sowie auch der jetzige Bundespräsident Fank-Walter Steinmeier gewesen.
„Es war ein rechtsfreier Raum, ich musste erst einmal rechtsstaatliche Grundlagen erkämpfen“, sagte Bernhard Docke. Dabei war von Beginn an völlig klar, dass Kurnaz nichts mit den Anschlägen zu
tun hatte, also eindeutig unschuldig war. „Die Menschen in Guantanamo verloren alle Grundrechte, das darf nicht sein“, erläuterte der Jurist, wobei ihm eine gewisse Fassungslosigkeit auch nach
all den Jahren noch anzumerken war.

Kein Politiker habe sich je bei Murat Kurnaz oder seiner Mutter entschuldigt, klagte er, schloss dann aber doch noch positiv. „Murat hat sich seinen Humor bewahrt und ins Leben zurückgefunden. Das ist bei Folteropfern selten“
Um Leid, Angst und das Gefühl von Hilflosigkeit ging es auch in der Diskussion um Jonas Kaufmanns Film. Ihm zur Seite stand Roman Sachuk, den er bei seinem Trip an die Grenze kennenlernte und der
auch eine wichtige Rolle im Film spielt. Roman studierte, als Putin sein Heimatland überfiel, floh zunächst nach Polen und lebt aktuell in Deutschland. Zwar werden sein Schulabschluss und sein
Studium hier nicht anerkannt, doch er spricht fließend mehrere Sprachen, so dass er hoffnungsvoll ist, irgendwann auch wieder eine Zukunft zu haben.
Diese direkten und authentischen Eindrücke kamen bei den Schüler*innen gut an, es entwickelte sich eine sehr lebhafte Diskussion, für die einige sogar noch länger blieben. Ja, die sogenannte
Generation Z ist durch die vielen Krisen in der Welt verunsichert, doch sie hat auch Hoffnung. Das wurde an diesem Tag sehr deutlich. Viele Jugendliche sind sich der Zerbrechlichkeit unserer
Gesellschaft und eben unserer Demokratie bewusst, ebenso aber bereit, sie selbst zu gestalten und eben auch zu verteidigen. Denn verglichen mit vielen anderen leben sie doch ein sehr
privilegiertes Leben und sind alles andere als machtlos.
Normal neu denken
Warum es wichtig ist, mit Kindern über Rassismus zu reden
Ein Kind im Morgenkreis will nicht stillsitzen. Die Stimmung der Erzieherin ist angespannt, die der anderen Kinder auch. Mit dieser Szene konfrontierte der Diplom-Sozialpädagoge und Therapeut Klaus Kokemoor etwa 300 Mitarbeitenden eines Kindertagesstättenverbandes in Einbeck. Die Anspannung greift sogar auf sie über, da sie alle eine ähnliche Situation kennen.
Kurz darauf zeigt Kokemoor eine Szene, in der das Kind nun außerhalb des Kreises herumturnt, während alle anderen ganz normal ihrer Morgenroutine nachgehen. Der Kreis wurde sozusagen erweitert,
neues Verhalten wurde integriert. Für die Kinder, so der Referent, ist es meist nicht schwer, anderes Verhalten zu akzeptieren, es wird für sie als Eigenheit normal, wenn wir als Erwachsene ruhig
mit der Situation umgehen.
Noch einige weiterer solcher Fallbeispiele hatte Klaus Kokemoor auf Video mitgebracht, die er gemeinsam mit dem Auditorium analysierte. So berichtete er beispielsweise von Kindern, die anfangs um
sich schlugen, später aber in die Gruppe integriert werden konnten, weil mit ihnen individuell, vielleicht unkonventionell, wertschätzend und akzeptierend umgegangen wurde.
„Wir gehören zu den Berufsgruppen, die nicht durch `ne KI ersetzt werden können“, machte er den Anwesenden auf humorvolle Weise Mut und lobte ihre manchmal schwierige, doch enorm wichtige Arbeit.

Einen zweiten Vortrag gab es von der Kulturwissenschaftlerin Olaolu Fajembola und der Entwicklungspsychologin Tebogo Nimindé-Dundadengar. Bei ihnen ging es um rassismuskritische Bildung und Möglichkeiten zur Förderung von Diversität in der frühkindlichen Erziehung, was vielleicht erst einmal nach einem ziemlich harten Brett klingt.
Allerdings schafften es auch die beiden Referentinnen, die zusammen Bücher zu dem Thema schreiben und einen Onlineshop für Spielzeug und Bücher für Kinder aller Herkünfte gründeten, ihre
Zuhörer*innen mitzunehmen. Es war weniger ein Vortrag als ein gelenkter Austausch, zu dem sie aber etliche interessante Impulse beisteuerten.
Kinder machen keine Unterschiede, heißt es, stellte Tebogo Nimindé-Dundadengar in den Raum. Das stimme nicht, denn sie unterscheiden schon früh zwischen Unbekanntem und Bekanntem. Kinder haben
keine Vorurteile, heißt es. Aber sie übernehmen sehr schnell Stereotypen und halten sie für normativ. Kinder lernen Vorurteile von den Eltern, heißt es. Nicht nur, denn auch Kinderbücher,
Fernsehen etc. spielen dabei eine große Rolle.

Genau deshalb sei es so wichtig, dass schwarze Menschen in Geschichten nicht per se böse sind, dass versteckter Alltagsrassismus nicht (zum Teil unbewusst) medial reproduziert wird. Und das gilt natürlich ebenso für unser alltägliches Miteinander. Sie selbst habe es immer wieder erlebt, dass Menschen ihr ungefragt in die Haare fassen. Nicht einmal böse gemeint, aber definitiv nicht okay und insbesondere für Kinder ein Verhalten von Erwachsenen, das sie prägt.
„Wir finden es wichtig, das Wort Rassismus auszusprechen“, vertraten beide ihren Standpunkt. Zunächst müssten Erwachsene verstehen, was eigentlich rassistisch ist, bevor sie anschließend mit
Kindern darüber reden. Das sei ohne weiteres möglich, denn Kinder haben ein starkes Gerechtigkeitsbedürfnis, so Olaolu Fajembola.
Eine Studie habe ergeben, dass aktuell vor allem muslimisch gelesene Familien mit negativen Verhaltensweisen stigmatisiert werden. Vieles davon werde aber nicht thematisiert und aufgearbeitet,
was dann zu Verunsicherungen vieler Menschen und dazu führt, dass Children of Color in unserem Bildungssystem ungeachtet ihrer Leistungen abgestraft werden, und letztlich eben auch zu einem
Erstarken rechtsextremer Parteien, wie wir es in den letzten Jahren erleben.

Während ich dort saß und mir Notizen für den Artikel machte, den ich für den Kirchenkreis darüber schreiben wollte, musste ich an ein Interview mit Ranga Yogeshwar denken, das ich mal geführt hatte. Damals noch für das Bollywoodmagazin ISHQ. Es war ein Telefoninterview, ich war aufgeregt, weil Ranga tatsächlich zugesagt hatte, und noch mehr, weil er sich echt Zeit nahm und offenbar gerne meine Fragen beantwortete. Na das wäre mal Stoff für eine eigene Geschichte.
Auf jeden Fall ging es in unserem Gespräch um die indischen Gesellschaftsstruktur und somit auch um das Kastensystem. Das will ich jetzt hier gar nicht erläutern, doch in Kurzform bedeutet es ja, dass Menschen traditionell in bestimmte Kasten hineingeboren werden, denen sie dann auch ihr Leben lang angehören. Und diese Kasten entscheiden über die gesellschaftliche Stellung und eben auch über die Chancen und Möglichkeiten, die jemand im Leben hat.
Nun zog Ranga Yogeshwar allerdings schnell Parallelen zu unserer Gesellschaft und machte mir dann sehr deutlich klar, dass es seiner Meinung nach auch bei uns ein solches System gebe, nur sei es eben von außen weniger sichtbar und greifbar. Der Sohn eines Arbeitslosen werde in unserer Gesellschaft nur selten Arzt, sagte er, weil schon in der Schule die Bildung und der Beruf der Eltern eine enorme Rolle spiele. Im Grunde seien die gesellschaftlichen Unterschiede bei uns sogar deutlicher als in Indien, das war seine klare Position.
Dieser Punkt ist mir immer im Gedächtnis geblieben. amals war ich ehrlich gesagt ein wenig schockiert, wollte es am liebsten von mir schieben. Je häufiger ich seine Aussage an der Realität maß, desto weniger konnte ich sie wegschieben. Sowohl in meinem Lwehramtsstudium als auch jetzt später im Leben als Journalist finde ich immer wieder Beispiele, dass unser Kastensystem sehr sehr starr ist. Daran musste ich beim Vortrag von Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar immer wieder denken und finde es daher so enorm wichtig, darüber zu schreiben.
Das Frühwarnsystem der Demokratie
Interview mit dem Niedersächsischen Verfassungsschutzpräsidenten Dirk Pejril
Dirk Pejril ist Präsident des Verfassungsschutzes in Niedersachsen. Privat kenne ich ihn schon lange, wollte auch schon immer mal ein Interview mit ihm machen. Vielleicht ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür.
Uns allen ist der Verfassungsschutz ein Begriff, aber was macht ihr eigentlich?
Jetzt stellst du mir eine Frage, die für die nächste halbe Stunde bis Stunde füllend wäre.
Ich würde dich bitten, es abzukürzen.
Mache ich gerne (lacht). Wir sind Teil der Exekutive, also nicht zu verwechseln mit dem Verfassungsgericht. Meine Behörde ist Teil des Innenministeriums. Wir sind mit unseren Befugnissen ganz
klar an Recht und Gesetz gebunden, das ist für uns die absolute Messlatte und Maßstab für die Überprüfbarkeit unserer Arbeit.
Ist der Bundesverfassungsschutz dem Bundesinnenministerium und der Niedersächsische Verfassungsschutz dem Landesinnenministerium untergeordnet?
Es ist wie bei der Polizei, Verfassungsschutz ist Ländersache. Jedes Land hat einen eigenen Verfassungsschutz. Und es gibt das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Behörden sind unterschiedlich
organisiert und alle haben ihre eigenen Gesetze und geregelte Zuständigkeiten.
Wir sind das Frühwarnsystem zum Schutz der Demokratie. Wir sind dafür da, die Lehren aus der Weimarer Republik zu ziehen. Wenn die Demokratie in Gefahr gerät, sind wir dazu da, frühzeitig den
Finger zu heben und die Politik, aber auch die Menschen im Land zu sensibilisieren. Wir sind kein Geheim-, wir sind ein Nachrichtendienst. Wir sammeln, analysieren und bewerten Informationen und
bereiten Sie für die Politik auf und machen sie öffentlich zugänglich.

Stichwort Demokratie schützen... glaubst du, dass sie im Moment in Gefahr ist?
Ja, ich glaube, wir haben vielleicht sogar die turbulenteste Zeit seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt momentan so viele Themen, die sozusagen auf die Demokratie einwirken, vom
Rechtsextremismus, Linksextremismus, bis hin zu islamistischen Anschlagsversuchen und Anschlägen oder antizionistische, antiisraelische Demonstrationen. All diese Themen sind
verfassungsschutzrelevant. Ich finde, wir haben eine besorgniserregende Zeit.
Aber viele der sogenannten Gefährder kennt ihr ziemlich gut, oder?
Handelnde Personen im Rechtsextremismus, Linksextremismus und auch Islamismus sind immer Thema bei uns, das Anschlagsrisiko ist abstrakt, aber weiterhin hoch. Wir wissen aber auch um
internationale Terrorgruppierungen, die nicht weg sind. Die sind bei uns ein Dauerthema. Die Gefahr radikalisierter Einzeltäter ist groß.
Wie beobachtet der deutsche Verfassungsschutz im Ausland Dinge, die für euch eventuell relevant werden?
Für die Beobachtung des ausländischen Terrorismus ist zunächst der Bundesnachrichtendienst zuständig, in enger Zusammenarbeit für deutsche Belange dann mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz.
Hier arbeiten die Sicherheitsbehörden der Länder und des Bundes sehr eng zusammen. Denn auch wir beobachten zum Beispiel beim Thema Spionage, insbesondere seit dem Angriffskrieg Putins auf die
Ukraine eine – ich will mal sagen – besorgniserregende Renaissance. Analog wie digital.
Das Digitale spielt eine immer größere Rolle, oder?
Na klar, Cyberspionage - Cyberabwehr sind ein großes Thema. Es bestehen aktuell vielerlei Bedrohungsszenarien für unser Land. Es sind gezielte Angriffe von staatlichen und nichtstaatlichen
Gruppierungen aus dem Ausland auf Privatleute, auch kleine Unternehmen, öffentliche Verwaltungen oder auch die Regierung.
Deutschland wird momentan heimgesucht von Desinformationskampagnen. Es geht dabei insbesondere darum, Politiker verächtlich zu machen und das Regierungshandeln zu diskreditieren. Es geht darum,
Vertrauen zu untergraben, die Menschen zu verunsichern und Menschen bösgläubig zu machen. Da werden die Ängste der Menschen mit Blick auf die Krisen unserer Zeit gezielt ausgenutzt.
Spielt KI für euch eine große Rolle?
Das ist ein Thema für die Strafverfolgungsbehörden und für die Sicherheitsbehörden, natürlich. KI schafft ganz andere Manipulationsmöglichkeiten. Aber auch im positiven Sinne entstehen umgekehrt
Möglichkeiten für die Behörden zur Analyse und Auswertung.
Wir müssen über zwei „Elefanten im Raum“ reden. Wie kann es passieren, dass ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident jetzt zum Beobachtungsfall wird?
Das kann ich nur schwer kommentieren, da ich Herrn Maaßen nie persönlich kennengelernt habe und dass alles vor meiner Zeit war. Und ich habe keine sachverhaltsbezogenen Informationen. Natürlich
bin ich auch irritiert über so eine Entwicklung, dass jemand, der in der Sicherheitsarchitektur Deutschlands eine herausragende Rolle spielte, sich dann in einer Art und Weise verhält, die ich
befremdlich finde. Ich finde es bedauerlich, weil es eben auch ein Imageverlust ist, nicht nur fürs Bundesamt, sondern auch insgesamt für die Frage: Was machen die Verfassungsschützer? Denn
nichts ist schlimmer, als wenn man denen, die unsere Verfassung schützen sollen, nicht mehr trauen kann.
Er ist ja jetzt jemand, der das Vertrauen untergräbt, indem er behauptet, die Ampel diktiere alles...
Oft wird mir gesagt, ich sei ja Teil der Exekutive und weisungsgebunden. Ja, ich bin ja auch Beamter. Aber ich bin natürlich an Recht und Gesetz gebunden und meine Mission, mein Auftrag ist,
immer danach zu handeln. Es gibt klare gesetzliche Regelungen für die Arbeit meiner Behörde, auch für die Ministerin, so dass eine Objektivität hergestellt wird. Da ist ein sehr, sehr hohes Maß
an Neutralität sichergestellt.
Der zweite „Elefant“ ist die AfD. Weshalb ist sie in manchen Ländern Verdachtsfall und in anderen gesichert rechtsextrem?
Weil sich die AfD auch unterschiedlich darstellt und verhält. Bei uns ist sie als sogenannter Verdachtsfall eingestuft, das ist die untere Stufe unserer Beobachtungsmöglichkeiten. Die AfD
Niedersachsen gibt sich aktuell gemäßigt, gleichwohl sind Kräfte aus dem sogenannten Flügel auch in Niedersachsen immer noch da. Der Flügel ist erwiesenermaßen rechtsextremistisch, hat sich
mittlerweile für aufgelöst erklärt, doch seine Ideologen agieren noch. Insgesamt tritt die AfD in Niedersachsen nicht ganz so offensichtlich rechtsextremistisch auf wie beispielsweise in
Thüringen unter der Leitung von Björn Höcke.
Aber heißt das nicht auch, dass ich unter dem Radar bleiben kann, wenn ich eure Regularien kenne?
Ja, das ist eine Situation, die wir auch im Blick haben. Klar ist ja, dass Menschen, die mal in einer extremistischen Gruppierung gewirkt haben, nicht aufhören, nur weil die Organisation nicht
mehr da ist, sich vordergründig aufgelöst hat. Das rechtsextremistische Gedankengut bestimmt ja auch weiterhin das Handeln.
Die Ehrung von Björn Höcke in Northeim beispielsweise ist für mich schon ein Zeichen, dass die gemäßigte Fassade das Transparent herunterlässt und die AfD Niedersachsen ihr wahres Gesicht blicken
lässt.
Wenn die AfD verboten werden sollte, macht euch das die Arbeit nicht viel schwerer?
Meist wird die Frage ja andersherum gestellt, warum die AfD nicht ganz schnell verboten wird. Ich finde es schon wichtig, da differenziert heranzugehen. Aus Sicht des Verfassungsschutzes ist es
unsere Aufgabe, in der aktuellen „Verdachtsphase“, be- und entlastende Informationen zu sammeln, um die Frage eines Parteienverbotsverfahren als schärfstes Schwert unserer Verfassung bewerten zu
können. Wir haben hier zunächst beratende Funktion gegenüber der Politik. Dazu zählt auch die Frage, welche Risiken und „Nebenwirkungen“ ein Verbot entfaltet. Ist damit die Ideologie, ist die
Wählerschaft auch verschwunden? Wie erreiche ich die Menschen, die einer solchen Partei nachgelaufen sind, um sie von einer demokratischen Politik und den Werten unserer Verfassung zu überzeugen?
Die schriftliche Version ist natürlich etwas gekürzt, deshalb habe ich euch ja auch die lange Version als Audiointerview zur Verfügung gestellt.
Kirche mischt sich ein
Gibt es theologische Gründe gegen Rechtsextremismus?
In Northeim wurde kürzlich Björn Höcke von der dortigen AfD-Kreistagsfraktion geehrt. Das rief Protest hervor, der Ratssaal der niedersächsischen Stadt sei nicht dafür da, um thüringische Rechtsextremisten zu ehren, so könnte man es überspitzt formulieren. Auf jeden Fall riefen die Stadt, der Rat und eben auch die Kirche zu einem Protest, einer symbolischen Menschenkette um den Ratssaal auf.
Der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Leine-Solling, Jan von Lingen, unterstützte die Aktion von Anfang an. „Das ist nicht mein Northeim, wenn ein Mensch, der vom Verfassungsschutz
als rechtsextrem eingestuft wird, in Northeim einen Preis bekommt und seinerseits Northeim als ein ´Kraftzentrum´ der AfD bezeichnet.“
Zur Demonstration kamen laut Polizei 800 bis 1000 Menschen – ein deutliches Zeichen, wenn natürlich auch nichts gegen die Zahlen aus größeren Städten. Neben Bürgermeister Simon Hartmann sprachen
unter anderem auch die Bundestagsabgeordneten Frauke Heiligenstadt und Karoline Otte und eben Jan von Lingen. „Wir sind anders“ rief er Höcke und der AfD sozusagen entgegen, Northeim steht nicht
für rechte, faschistische und extremistische Ideologien. Warum aber beteiligt sich die Kirche überhaupt an einer solchen Demonstration, bezieht Stellung zu politischen Themen?

„In der hannoverschen Landeskirche haben wir eine Kirchenverfassung. Darin sind wir aufgerufen, als Christinnen und Christen Mitverantwortung für das demokratische Gemeinwesen zu übernehmen. In allen Auseinandersetzungen muss genau diese Demokratie die gemeinsame Basis sein“ sagt der Superintendent dazu. Weiterhin bekräftigt er: „Wir sagen sehr deutlich: Rechtsextremismus widerspricht fundamental den christlichen Grundüberzeugungen und Maßstäben. Dazu haben wir auch 10 Thesen gegen Rechtsradikalismus im Kirchenkreis verabschiedet. Wir halten uns an die Bibel, in der es heißt: ‚Suchet der Stadt Bestes.‘ (Jer. 29,7).“
Seine Haltung für den thüringischen AfD-Vorsitzenden bringt er klar zum Ausdruck: „Es kann es nicht sein, dass mit der Ehrung des thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke in Northeim
hoffähig und preiswürdig ist, was vom Verfassungsschutz in Thüringen als verfassungsfeindlich eingestuft und beobachtet wird.“
Auch im benachbarten Osterode gab es wie in so vielen Städten eine Demonstration für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Es kamen 2000 Menschen und auch hier beteiligte sich die Kirche. Und auch hier fragte ich die Superintendentin des Kirchenkreises Harzer Land, Ulrike Schimmelpfeng, nach einer Begründung. Ihre Haltung ist ebenso klar wie die von Jan von Lingen.

„Als Christinnen und Christen haben wir die Aufgabe, Jesus nachzufolgen so gut wir können“, sagt sie, „Dieses Engagement hat Konsequenzen für alle unsere Lebensbereiche. In der Familie, unter Arbeitskollegen und in unserer Stadt und unserem Land haben wir den Auftrag für Nächstenliebe einzustehen.“ Christliche Nächstenliebe also, die nicht zulässt, manche Dinge schweigend hinzunehmen.
Ganz konkret sagt sie weiterhin: „Wenn Menschen in unserem Land andere Menschen herabsetzen, verachten und ausgrenzen, dann müssen Kirchenmitglieder widersprechen, weil alle Menschen
gleichermaßen von Gott geliebte Geschöpfe sind.“ Das ist eine klare Absage an gewisse Ideologien und ein Bekenntnis zu Pluralismus und Vielfalt.
Ist das also ein theologischer Grund, um gegen Rechtsextremismus zu sein? Für Ulrike Schimmelpfeng ganz klar. „Für Christinnen und Christen sind alle Menschen auf dieser Erde als Gottes
Ebenbilder von Gott gewollt und mit der gleichen Würde ausgestattet. Die rechtsextreme Haltung aber stellt die Gleichheit aller Menschen infrage.“

In Bezug auf die Nächstenliebe geht sie noch weiter und führt aus: „Jesus Christus hat Nächstenliebe gelebt, er hat sich kranken, behinderten und ausgegrenzten Menschen zugewandt. Im Rechtsextremismus hingegen wird Schwachheit verachtet. Jesus war Jude, für uns ist heute Gott sei Dank klar, dass jüdische Menschen unsere Geschwister im Glauben an den einen Gott sind. Rechtsextremismus aber steht für Antisemitismus.“
Diese Sichtweise ist nicht nur ihre subjektive. Sie zitiert die Barmer Theologische Erklärung von 1934, die zentrale theologische Äußerung der Bekennenden Kirche unter der nationalsozialistischen
Herrschaft, die sich gegen die falsche Theologie jenes Kirchenregimes wandte, das sich den Nationalsozialisten anglich.
„Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären...“, heißt es dort. Dazu führt die Superintendentin
heute aus: „Rechtsextremismus meint, wenn eine bestimmte Führungselite das Sagen hätte, der sich alle unterordnen würden, dann wäre alles besser – als Christinnen und Christen wissen wir uns aber
allein Gott als unserem Herrn verpflichtet.“
Für mich, der ich aus tiefer innerer Überzeugung an vielen dieser Demos momentan teilnehme und der ich noch tiefer von der christlichen Botschaft überzeugt bin, waren das interessante Statements. Beide Superintendenten lieferten mir ein Stück weit Begründungen für das, was ich zwar fühle, aber so vielleicht nicht hätte in Worte fassen können. Außerdem - und vielleicht ist das sogar noch wichtiger - zeigt es für mich aber auch, dass Kirche wichtig für unsere Gesellschaft ist, eben weil sie den moralischen Boden für vieles bereitet, worauf unser humanistisches Abendland aufgebaut ist.
Vertrauen ist die Basis einer Gesellschaft
Geschichte darf sich nicht wiederholen
Wie lässt sich ein erneuter Rechtsruck, eine Wiederholung der Geschichte des Dritten Reiches verhindern? Dieser Frage ging Prof. Dr. Dr. h.c. Dietz Lange im Schulzentrum in Duderstadt nach. Da ich diesen Vortrag wirklich spannend fand und er mir auch eine neue Sichtweise eröffnete, will ich ihn euch hier zusammenfassen und auch an einigen Stellen kommentieren.
Die derzeitigen Demonstrationen, so ein Teil seiner Antwort, hält er für besser und wirkungsvoller als ein Verbot der AfD. Im Vorfeld der Machtergreifung Hitlers sei vor allem das Vertrauen in die staatliche Ordnung zerstört worden, so Dietz Langes Ausgangsthese. Auch heute „faseln politische Extremisten von der Lügenpresse“, bekräftigen Verschwörungstheorien und wollen tausende Menschen ausweisen, zog er eine Verbindung.
Es war eine Veranstaltung zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, über die ich berichten sollte. Das ist nach wie vor ein wichtiges Thema, besonders interessiert es mich allerdings immer, wenn es nicht nur historisch bleibt, sondern auch angesprochen wird, was dieser düstere Teil unserer Geschichte denn heute für uns bedeuten kann, bedeuten muss. Gleich mit seinem Einstieg hatte der 90-jährige Professor mich daher gepackt und ich war gespannt, welchen Bogen er spannt.

Das Vertrauen ist also die Basis, persönlich, öffentlich und auch religiös. Selbstverständlich sei es auch gesund, zu misstrauen, das sei ein Schutz, doch es dürfe nicht die Herrschaft übernehmen. Diktaturen bauen immer auf Misstrauen auf, führte er aus, allerdings müssten Menschen darauf vertrauen, dass sie in einer Gesellschaft sicher sind. Um genau dies zu untergraben, werden von einigen Kräften Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt, der Staat und auch die Wissenschaft (beispielsweise beim Thema menschengemachter Klimawandel) werden infrage gestellt.
Ebenso das Gottvertrauen, so Prof. Lange weiter, wodurch Unsicherheiten geschürt werden. „Diese Entwicklung lässt sich schwer rückgängig machen“, sagte er, denn sie zeige sich schon seit dem
Mittelalter. Damals ging man von einer gottgegebenen Ordnung aus, mit immer neuen Entwicklungen und Entdeckungen der Neuzeit wuchs die persönliche Kontrolle des Menschen, was als Nebenwirkung
eben eine Vertrauenskrise mit sich brachte.
Unsere Gesellschaft wurde komplizierter, der zunehmende Pluralismus verunsicherte, Orientierung wird immer schwerer. Das nutzen Populisten immer wieder, indem sie mit Vereinfachungen arbeiten.
Dem gegenüber stehen Fakten, ebenso die Achtung der Verschiedenheit und die Einsicht, dass niemand absolutes Wissen hat. Das religiöse Vertrauen hilft uns laut Dietz Lange dabei, auf einem festen
Fundament zu stehen und uns gegen Verunsicherungen und Fake News abzusichern.

Zwar gebe es keinen Beweis, sondern lediglich Indizien, doch Gottes Kosmos sei geordnet und könne uns Orientierung geben, erklärte er. Ja, die tausendfachen Morde an Juden im Dritten Reich erschütterten für viele Menschen das Vertrauen in einen guten und allmächtigen Gott, so dass wir heute oft ohne Glauben an ihn leben. Auf diese Zweifel gebe es keine zufriedenstellende Antwort, dennoch ist er überzeugt, dass das Vertrauen in Gott unsere Gesellschaft und uns bis ins Private helfen und festigen kann.
Zudem sollen wir als Christen in der Welt wirken, fügte Prof. Lange an, was sich auch darin zeigen kann, dass wir mit vielen Menschen unterschiedlicher Überzeugung ins Gespräch kommen, andere
Sichtweisen nachvollziehen und so immer wieder zu dem Schluss kommen, dass eine vielfältige Gesellschaft mit gegenseitigem Respekt jedem Menschen gegenüber die einzig mögliche, die einzig
lebenswerte ist.
Es gab dann im Anschluss eine Diskussion, in der dann zum Beispiel kritisiert wurde, dass er die unrühmliche Rolle der Kirche im Dritten Reich nicht angesprochen habe. Sicher, auch das muss heute noch aufgearbeitet werden, allerdings ging es in diesem Vortrag ja nun mal um einen anderen Aspekt und letztlich um eine ganz klare These Dietz Langes. Für mich jedenfalls war es als Vortrag vollkommen rund.
Dennoch frage ich mich natürlich, ob mehr Gottvertrauen wirklich dazu führt, dass wir offenere und demokratischere Gesellschaften haben. Das wäre ja im Prinzip der Rückschluss. Als Christ bin ich definitiv der Meinung, unsere Welt sei friedlicher und gerechter, wenn wir alle Prinzipien der christlichen Ethik zugrundelegen. Doch selbst dann sind wir alle immer noch Menschen und Macht verführt meiner Meinung nach immer zum Egoismus. Insofern glaube ich nicht, dass Gottvertrauen die einzige Lösung ist. Sagt der Professor ja auch nicht, ich weiß.
Spannend bleibt für mich jetzt aber die Frage, was es denn braucht, damit eine Gesellschaft, eine Demokratie stark gegen Faschismus, gegen Korruption, gegen Ungerechtigkeit, gegen Machtmissbrauch in welcher Form auch immer ist. Ja, auf jeden Fall Werte wie Nächstenliebe, Toleranz und gegenseitigen Respekt. Nur ob das ausreicht, daran zweifle ich angesichts unserer momentanen politischen Lage leider immer wieder.
Demokratie in Gefahr
Die Spaltung der Gesellschaft wird sichtbar
Lange Reihen von Polizist*innen trennen die Kreuzung vorm Göttinger Rathaus (Hiroshimaplatz/Bürgerstraße) strikt und unnachgiebig. Auf beiden Seiten Demonstrierende, auf der einen Seite Querdenker, Reichsbürger und Rechte, auf der anderen zahlreiche Institutionen und Gruppen zur Gegendemo.
Die Polizei hat sich lange auf diesen Tag vorbereitet und Einsatzkräfte von Osnabrück bis Erfurt angefordert, denn die Querdenker haben Tausende Teilnehmer angekündigt. „Versammlungsfreiheit
statt Extremismus“, so ihr Motto.
Versammelt hatten sich einige Mitglieder der rechten Szene ja im November in einem Hotel in Potsdam, so berichtete das Recherchezentrum Correctiv gerade, versammelt mit Mitgliedern der AfD,
Mitgliedern der Werte-Union, der identitären Bewegung, Unternehmern und anderen. Dabei ging es um die Deportation von Ausländern und jenen, die nicht für deren Abschiebung sind, um Remigration,
wie sie es nennen, also um ein moderner verpacktes „Ausländer raus“.

Gerade diese Veröffentlichung hatte viele bewogen, sich der Gegendemo anzuschließen, zu der unter anderem das Göttinger Bündnis gegen Rechts mit den „Omas gegen Rechts“, dem DGB und vielen anderen unter dem Motto „Querdenken einfrieren“ aufgerufen hatte. Leider bestätigte das Wetter genau das, doch nach brennenden Barrikaden beim letzten Aufeinandertreffen beider Fronten wussten alle sowieso, dass sie sich – wenn auch im übertragenen Sinn – warm anziehen mussten.
Deeskalation war der Grundsatz der Polizei, das große Aufgebot und die Positionierung an vielen Straßen und Knotenpunkten der gesamten Innenstadt sprach dafür, dass es nicht zu Konflikten und
Krawallen auf der Marschroute der Demos kommen sollte.
In den Kundgebungen der Querdenker ging es gegen links-grün-versiffte Demonstranten, gegen die Mainstream-Medien, gegen die Antifa, gegen Coronamaßnahmen und es wurde Hoffnung in die Wahlen in
Deutschland und den USA, also in die AfD und Trump, sowie in den Friedensbringer Putin verlautbart. Auf der Gegenseite wurde ein Zusammenhalt demokratischer Kräfte bekundet und die Ablehnung des
Faschismus.
Während die Gegendemonstranten später friedlich durch die Fußgängerzone zogen, kamen die Querdenker an vielen Stellen nicht voran, da sich Sitzblockaden gebildet hatten, die ihren Weg
blockierten. Diese Gegendemonstranten wurden zum Teil nach mehrmaligen Aufforderungen der Polizei letztlich von der Straße getragen, zum Teil wurde die Querdenken-Demo umgeleitet. Dieses Spiel
wiederholte sich wieder und wieder, zum Teil auch unter Einsatz von Pyrotechnik und mit brennenden Mülltonnen, so dass auch die Feuerwehr ausrücken musste.

Laut Polizei waren etwa 450 Querdenker und mehr als 2500 Gegendemonstranten unterwegs. Es gab einige vorläufige Festnahmen, beschädigte Fensterscheiben, aber wohl keine Verletzten. Insgesamt elf Demonstrationen waren angemeldet, die die Polizei jederzeit im Griff zu haben schien, so dass die von manchen erwarteten großen Krawalle ausblieben.
Was aber in jedem Fall bleibt, ist eine tiefe Spaltung der Gesellschaft. Auf der einen Seite stehen die, die dem Staat, den Medien, der Wissenschaft misstrauen und eine Abschottung vor der Welt
und auch vielleicht der Gegenwart und Zukunft wollen. Auf der anderen Seite wächst bei vielen anderen die Angst vor einer Wiederholung der deutschen Geschichte, vor Rassismus, Faschismus und
Totalitarismus und vor einer Abschottung vor der Welt und der Gegenwart und Zukunft.
Zu jener Seite zähle auch ich mich, denn ich glaube nicht, dass diese Demo die letzte ihrer Art war, und fürchte, weitere, deutlich aufgeladenere und schwerer kontrollierbare werden folgen. Was
mir im Moment noch Hoffnung macht, sind die nackten Zahlen, die für eine Mehrheit der überzeugten Demokraten sprechen und eben auch eine Exekutive, die ein heftigeres Aufeinandertreffen beider
Fronten verhindern kann.
Ob das allerdings immer so bleibt, weiß ich nicht. Was werden die nächsten Wahlen bringen, wenn sich ein großer Teil der Bevölkerung gegen demokratische Parteien ausspricht? Wie weit können
Menschen noch von Populisten manipuliert und aufgehetzt werden, wenn nicht einmal Meldungen über geplante Deportationen dazu führen, dass sich viele Menschen umgehend von dieser Bubble
distanzieren?
Reichsbürger als Nachbarn
Der Fall des Hotels am Wiesenbeker Teich - Teil 2
Da mich das Thema Reichsbürger - und die dann auch noch fast in der Nachbarschaft - alarmierte, wollte ich über das Hotel, über den spannenden Lost Place, in dem ich leider nie war, berichten. Doch meine Chefin meinte damals, sie wolle diesen Leuten auf ihrer Plattform keine Bühne bieten. Zum Teil kann ich das Argument sogar nachvollziehen, bin aber nach wie vor der Ansicht, dass Aufklärung wichtig ist.
Irgendwann tauchte auf Youtube ein Video von Taccos World auf, der Lost Places aufsucht und eben auch dieses Hotel. Dabei hatte er Kontakt mit der Eigentümerin, half ihr sogar beim Entrümpeln der
Bude. Als er erfuhr, dass sie Reichsbürgerin ist, gab es dann ein weiteres Video und eine Distanzierung von ihm.
Natürlich schrieb ich ihn an, wollte gerne ein Interview mit ihm machen. Zuerst schien er dem auch nicht abgeneigt, doch kam mir eine andere Zeitung zuvor, die setzten ihn, wie ich später erfuhr
ein wenig unter Druck, so dass er sich bei mir anschließend nicht mehr meldete. Schade eigentlich.

Vor einigen Monaten gab es dann die Meldung eines Bombenalarms im Göttinger Kreishaus. Dort war ein verdächtiges Paket eingegangen, Absenderin war, wie sich später herausstellte die Reichsbürgerin und Hotelbesitzerin.
Die neuesten Nachrichten besagen nun, dass die Nutzung des Kiosks und verschiedener Wohnanlagen wegen baurechtlicher Bestimmungen untersagt werden, Grund sind – wer hätte es gedacht – fehlende
Baugenehmigungen und Bauanträge. Die Bauaufsicht könne Kiosk und Wohnanlagen versiegeln oder gar abreißen lassen, hieß es seitens des Landkreises, das Rechtssystem der Bundesrepublik werde auch
gegenüber Reichsbürgern durchgesetzt.
Alles in allem weiß also keiner, wie es weitergeht. Fakt ist aber, dass bei mir um die Ecke Menschen leben, die die Ansichten derer teilen, die einen Putsch oder Staatsstreich planten, Menschen,
die immer wieder und an verschiedenen Orten Grundstücke kaufen und sich so mehr und mehr ausbreiten. In Zeiten, in denen unsere Gesellschaft gespalten ist wie selten zuvor, in denen so vieles
wieder rausposaunt wird, was lange als unsagbar galt, in denen es meiner Meinung nach gewaltig brodelt, macht mir sowas Angst.

Das jedenfalls ist der persönliche Aspekt. Journalistisch gesehen bin ich immer noch überzeugt, dass es wichtig ist, diese ganze Geschichte im Blick zu behalten. Mindestens das. Eigentlich würde ich auch gerne einfach mal hinfahren und versuchen, mit der Besitzerin ein Gespräch zu führen.
Nein, ich weiß nicht genau, worauf ich mich da einlasse, ich weiß nicht einmal genau, wie ich in ein solches Gespräch einsteigen würde. Aber irgendwie möchte ich mir eben gerne selbst ein Bild
machen und erfahren, wie tief die Überzeugungen dieser Frau gehen, ob sie überhaupt bereit ist, mit der „Lügenpresse“ zu sprechen.
Auch wie genau ich einen Artikel schreiben würde, kann ich noch nicht sagen. Aufklären, einordnen, mit Fakten argumentieren, das auf jeden Fall. Aber erreicht man Leute aus diesem Dunstkreis
damit überhaupt noch? Oder bietet man ihnen tatsächlich nur eine Bühne, weil sie sich als missverstanden und als Opfer fühlen können? Zugegeben, ich bin noch unsicher. Aber auf jeden Fall werde
ich euch auf dem Laufenden halten.
Vom Lost Place zum Königreich
Der Fall des Hotels am Wiesenbeker Teich - Teil 1
Ein ehemaliges Hotel, malerisch gelegen an einem See inmitten von Bergen. Warum es zum Lost Place wurde, habe ich ehrlich gesagt bis heute nicht verstanden. Doch als ich zum ersten Mal dort war, stand es bereits seit etlichen Jahren leer, die Spuren des Verfalls waren deutlich zu sehen.
Allerdings gab es noch einen Besitzer, so hieß es, jemanden, der nicht dort, nicht in der Region, nicht einmal in Deutschland wohnte, sich daher auch nicht kümmerte. Jahre später hörte ich dann,
dass der Besitzer, vielleicht inzwischen ein anderer, doch dort wohne oder vielmehr hause, denn das Hotel verfiel zusehends.
Die Fassade wurde an vielen Stellen rissig, die einst bestimmt schicken Markisen über der Terrasse am See hingen nur noch in Fetzen, die Fenster waren so dreckig, dass man kaum noch durchgucken
konnte und im Inneren waren Berge von Schrott und alten Möbeln erkennbar. Kaum zu glauben, dass es noch bewohnt sein sollte, doch ehrlich gesagt habe ich mich auch nie getraut, nach einem Weg
hinein zu suchen.

Noch etwas später hieß es dann ziemlich plötzlich, dass das Hotel verkauft worden sein sollte. Zuerst wusste niemand etwas, dann kamen erste Gerüchte auf, schließlich hieß es, die neuen Besitzer seien Reichsbürger. Von da an berichteten auch mehrere regionale und überregionale Medien über den Fall und Menschen in der Umgebung zeigten sich beunruhigt.
Da der Wiesenbeker Teich bei Bad Lauterberg, also der Stausee vorm Hotel tatsächlich Weltkulturerbe ist, beruhigten die Behörden erst einmal, dass alle Baumaßnahmen erst einmal mit dem
Denkmalschutz abgesprochen werden müssten. In der Regel heißt das ja, dass nichts vorangeht, seitens der Reichsbürger oder vielmehr der neuen Eigentümerin gab es dann aber doch Verlautbarungen
über große Pläne.
Ein wie auch immer geartetes Zentrum des sogenannten „Königreich Deutschland“ sollte dort entstehen, Peter Fitzek, der selbsternannte König von Deutschland war sogar selbst vor Ort als dort
zunächst einmal ein Kiosk eröffnet wurde, bei dem man natürlich mit der eigenen Währung des Königreichs bezahlen konnte.

(Muss ich an dieser Stelle eigentlich erklären, was Reichsbürger sind? Eigentlich nicht, oder? Na ich tu es trotzdem. Also in Kurzfassung sind es Menschen, die die Bundesrepublik als Staat nicht anerkennen und sich stattdessen auf das Deutsche Kaiserreich oder das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 berufen. Sie lehnen jegliche Autorität unseres heutigen Staates ab und sind daher schon häufig strafrechtlich in Erscheinung getreten, unter anderem im vergangenen Jahr durch Umsturzpläne der Gruppe um Prinz Reuß, die durch alle Medien gingen.
Peter Fitzek ist selbsternanntes Oberhaupt seines „Königreich Deutschland“, für das er in den letzten Jahren Grundstücke kaufte, eine eigene Bank und eben auch eigenes Geld ins Leben rief. Auch
er hatte immer wieder Probleme mit der Justiz, wurde wegen schwerer Untreue verurteilt und auch wegen vorsätzlicher Körperverletzung.
Persönlich kam ich übrigens mit diesem Gedankengut zum ersten Mal in Berührung, als mir jemand erklärte, es sei doch seltsam, dass unser Ausweis ein Personalausweis sei, wir also Personal einer
BRD GmbH. Außerdem hätten wir ja keine Verfassung, das Grundgesetz sei nur vorläufig und außerdem gebe es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht einmal einen Friedensvertrag. Ziemlich abgedrehter
Scheiß? Ja. Aber es gibt leider ziemlich viele Menschen, die von genau diesem abgedrehten Scheiß überzeugt sind.)
Fortsetzung folgt...
Ohne Tabu
Sterben als Thema in der Jugendkirche
„Da arbeitest du über zehn Jahre für so’n Rummelsender und das kann am Ende dabei rauskommen“, sagte SternTV-Moderator Steffen Hallaschka. Gemeint ist die Serie „Sterben für Anfänger“, die jüngst mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Produziert wurde sie von Anne-Katrin Hallschka, moderiert von Steffen und Olivia Jones.
Am Samstag waren Anne-Katrin und Steffen Hallaschka in der Jugendkirche unseres Kirchenkreises zu Gast, um über ihr Projekt zu sprechen. Wenn ihr diesen Blog regelmäßig lest, erinnert ihr euch
vielleicht an die anderen Texte zu einer Vortragsreihe, die sich mit dem selbstbestimmten Sterben befasste. Das Thema Tod wird ja oft totgeschwiegen, ich finde es aber nach wie vor wichtig, dass
wir uns damit auseinandersetzen. Und die Serie „Sterben für Anfänger“ macht das auf eine ganz eigene, eine neue Art und Weise, die vielleicht nicht jedem gefällt.
„Wir wollten es unterhaltsam und ehrlich machen, ohne Tabus“, erklärte Anne-Katrin ihre Idee, die für ein Fernsehformat wirklich ungewöhnlich ist. Das nämlich konfrontiert Steffen und Olivia
Jones mit Menschen, die mit dem Tod zu tun haben, beispielsweise ein Bestatter oder zwei an Krebs erkrankte Frauen, die wissen, dass es für sie keine Heilung mehr gibt.

Diesen Menschen begegnen sie, unvoreingenommen, ohne vorherige Recherche, authentisch und sehr persönlich. Dadurch eben auch nahbar, verletzlich und manchmal sichtlich unsicher. Einige Szenen wurden gezeigt und anschließend vom Ehepaar Hallaschka kommentiert, ebenso ehrlich wie sie es im Fernsehen tun.
Interviewt wurden beide von Leonie Moritz und Sonja Abendrot vom Team der Jugendkirche, die zuvor verrieten, wie nervös sie doch seien. Auf der Bühne bzw. vorm Altar merkte das Publikum davon
nichts. Sie hatten etliche durchaus tiefgehende Fragen vorbereitet, schafften es aber auch, dem Talk die Leichtigkeit zu geben, die auch die Serie ausstrahlen will.
Alles, was gezeigt wird, sei natürlich und gehöre zum Leben dazu, erläuterte Steffen, deshalb wollte er auch weniger journalistisch und dafür umso persönlicher an dieses Format herangehen. „Wir
erleben Menschen, die mit offenen Augen das annehmen, was ihnen bevorsteht“, sagt er in Bezug auf eine junge Mutter, die zum Zeitpunkt der Reharbeiten schon wusste, dass sie die Ausstrahlung
vermutlich nicht erleben wird und das auch ihren Kindern beibringen musste.
Ein solches Schicksal berührt natürlich und erfordert Menschlichkeit noch viel mehr als journalistische Professionalität. Die beiden machten sehr deutlich, was ihnen diese Arbeit bedeutete und auch, welche Spuren die Menschen, denen sie begegneten, hinterlassen haben.
Warum ausgerechnet Olivia Jones? Nun, zum einen, weil sie die Dragqueen schon sehr lange kennen und auch schon lange die Idee fürs gemeinsame Projekt hatten, und zum anderen, weil es auch darum
gehen sollte, Images zu brechen und Menschen hinter ihren Fassaden zu zeigen. „Sie ist tiefgründig und keine Kunstfigur, sondern immer eine Variante von Oliver selbst“, sagte Anne-Katrin. Gerade
das habe die Arbeit für sie so spannend gemacht.

Was glauben Anne-Katrin und Steffen, was nach dem Tod kommt? Es gebe so viele Menschen, die Erfahrungen machen, die sich nach unseren Maßstäben nicht erklären lassen, antwortete Anne-Katrin darauf, sie glaube, dass da noch etwas sein muss. Steffen hingegen gab zu: „Ich bin mit dem Thema noch nicht ganz fertig.“ Wenn mit dem Tod aber alles vorbei wäre, mache das Leben doch keinen Sinn.
Ja ich muss zugeben, was die beiden erzählten und zeigten, hat mich bewegt. Zwar kannte ich Steffen Hallschka dem Namen nach, viel wusste ich allerdings nicht über ihn. Jetzt habe ich ein durchaus positives Bild, von Anne-Katrin natürlich auch und ehrlich gesagt sowieso von Olivia Jones, von der ich glaube, dass sie viel facettenreicher ist als das schrille Äußere vielleicht manchmal vermuten lässt.
Noch tiefer beeindruckt mich allerdings unsere Jugendkirche. Da sind Jugendliche, die sich eines solchen Themas annehmen, die sich trauen, ein solches Event auf die Beine zu stellen, und die es dann sehr professionell durchziehen. Das allein verdient größten Respekt, die Kontinuität, mit der sie sich in ihrer Jugendklirche seit Jahren ausprobieren ebenso. Das ist übrigens einder der Gründe, warum ich hoffnungsvoll in die Zukunft blicke, weil ich nach wie vor denke, dass die jetzige junge Generation in großen Teilen so viel reifer, so viel reflektierter ist als wir in dem Alter.
„Freiheit hat mit unserem täglichen Verhalten zu tun“
Wolfgang Huber referierte über Freiheit und Digitalisierung
„Wenn wir über Ausländer debattieren, sollten wir uns bewusst sein, dass wir nichts dazu beigetragen haben, hier geboren zu sein“, sagte Wolfgang Huber, Theologe und ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Umstände, unter denen wir leben, sind ja nun mal nicht von uins gemacht. Außerdem mache die Bibel schließlich schon auf ihrer ersten Seite deutlich, dass wir alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind.
Im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes war Wolfgang Huber in einer Schule in Hattorf zu Gast. Sein Publikum bestand somit überwiegend aus Schüler*innen, was diese Lesung besonders machte. Zunächst einmal freute sich der Schulleiter über den Besuch, ebenso wie der Theologe, der es zu schätzen weiß, wenn Jugendliche sich mit einem solchen Thema auseinandersetzen. Immerhin ist es ja durchaus komplex, insbesondere für eine solche Veranstaltung.
„Zu den Eigenheiten der Freiheit gehört es, dass sie ein Gefühl ist“, hielt er grundsätzlich fest. Daher kann sie unterschiedlich aufgefasst, empfunden und definiert werden. Seiner Ansicht nach sind wir frei, wenn wir die Urheber unseres Willens sind, wenn wir selbst Entscheidungen treffen und auch die Verantwortung dafür tragen. Damit hat Freiheit drei Aspekte, zum einen die Gestaltung des eigenen Lebens, dann die Verantwortung für andere und letztlich auch eine Ordnung des Gemeinwohls.

Das sei sein Zugang zum Thema Freiheit, verbunden mit der Überlegung, dass wir wohl aber unserem Leben eine Richtung geben können, viele Dinge also selber bestimmen. Daraus resultiert ein Gleichgewicht zwischen eigener Freiheit und der Freiheit anderer, das wir wahren sollten. Die würde einer und eines jeden müsse in einer Gesellschaft geachtet werden, es ist wichtig, dass Menschenrechte gelten. Gesellschaftlich gesehen, aber auch sehr persönlich. „Freiheit hat mit unserem täglichen Verhalten zu tun“, formulierte Huber.
Im zweiten Teil ging er auf das Thema Digitalisierung ein, die natürlich viele Möglichkeiten eröffnet, aber auch Gefahren für unser Zusammenleben mit sich bringt. Ist sie die neue Freiheit oder
letztlich doch das Ende der Menschheit als Krone der Schöpfung. Zumindest gibt es die Gefahr, dass Algorithmen uns unfrei machen, dass wir uns eine neue, künstliche Macht schaffen, die unser
Leben am Ende zu sehr bestimmt.
Der Theologe ging dabei auf literarische Science Fiction ein, die solche Szenarien häufig erschreckend gut aufzeigt, wurde aber auch sehr persönlich, indem er erzählte, wie soziale Medien etc.
auch für ihn schlicht Zeitfresser sind. Noch dazu zwingen sie uns, zur Öffentlichkeit, wir müssen oft mehr Persönliches im Netz preisgeben, als uns eigentlich lieb ist. Bewusst durch den Drang,
in der geschönten Onlinewelt mithalten zu können, aber auch unbewusst durch Daten, die im Hintergrund abgegriffen werden.

Zudem eröffnet die Digitalisierung viele Türen zur Manipulation und letztlich dazu, bestehende Ordnungen und auch die Gesellschaft zu ändern. Was wie eine Ausweitung der individuellen Selbstbestimmung wirkt, macht in letzter Konsequenz oft unfrei, so Huber.
Gerade über diese letzten Punkte wurde im Anschluss noch lange diskutiert. Es wurde ein reger Austausch zwischen den ethischen Ansichten eines sehr klugen und weitsichtigen Theologen, einigen
Erfahrungen und Anmerkungen verschiedenster Zuhörer*innen und eben auch den sehr unmittelbaren und oft in öffentlichen Diskussionen zu kurz kommenden Gefühlen und Sichtweisen der Jugendlichen.
Obwohl ich als Journalist dort war, also eigentlich nur neutral berichten wollte, konnte ich es mir nicht verkneifen, mich in der Diskussion zu äußern. In der Kürze der Zeit nämlich fand ich Hubers Darstellung der Digitalisierung zu negativ. Gerade in meinem Job erachte ich es als ungeheuren Zugewinn für unsere Gesellschaft und somit auch unsere Freiheit, dass inzwischen jede*r die Möglichkeit hat, sich im Netz zu äußern, dass Journalismus prinzipiell nicht mehr abhängig von Zeitungen und Verleger*innen ist.
Sicher, das fordert uns Journalist*innen heraus. Jeder darf sich mit dieser Berufsbezeichnung schmücken, auch wer nur auf Telegram Fake News oder verschwörerische Parolen teilt. Dennoch erachte ich die Entwicklung im Netz letztlich als eine Demokratisierung von Informationen, natürlich mit allen Problemen, die es zu regeln gibt, aber erst einmal auf jeden Fall einen Schritt zu mehr Freiheit und möglicher Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen. Zu gerne würde ich darüber noch einmal ausführlich mit Wolfgang Huber diskutieren, denn am Ende schloss er mit einem Satz, den ich so auch unterschreiben kann: Die digitale Entwicklung selbst sei nicht gut oder böse, „es hängt am Gebrauch.“
Krieg ist immer ein Krieg der Mächtigen
Auch in Israel und Palästina sehnen sich die Menschen nach Frieden
Im Oktober startete die palästinensische Hamas einen Großangriff auf Israel. Ziel war unter anderem ein Festival, das Liebe und Freiheit als Motto hatte und auf dem mehr als 3000 Menschen friedlich feierten. Mehr als 260 von ihnen wurden bei dem Terrorakt getötet, es gab weitere Todesopfer im ganzen Land, andere wurden gefoltert und entführt. Vor allem Zivilisten.
Solche Taten sind verabscheuungswürdig und müssen Konsequenzen nach sich ziehen. Andererseits brodelt es im Gazastreifen und darüber hinaus schon lange, jeder kriegerische Akt zieht
Vergeltungsschläge nach sich. Die Lage ist undurchsichtig, ich zumindest kenne viel zu wenig Hintergründe, um mir wirklich ein klares Bild zu machen.
Vor ein paar Jahren allerdings hatte eine Kirchengemeinde eine palästinensische Christin aus Bethlehem eingeladen, die über die Lebensumstände in ihrer Heimat berichtete. Aus ihrer Sicht
selbstverständlich, also aus palästinensischer Perspektive und damit rein subjektiv. Trotzdem hat mich dieser Vortrag beeindruckt.

Gebete, die Mauern einstürzen lassen sollen, sind in Deutschland selten geworden, sagte M. (als Vorsichtsmaßnahme nenne ich den Namen hier nicht) damals. An diesem Abend jedoch wurde genau dafür gebetet, für ein Ende der Konflikte zwischen Israel und Palästina, für Frieden auf beiden Seiten der Mauer im Heiligen Land. Zuvor hatte M. in bewegenden, teils poetischen und häufig feinsinnig ironischen Worten vom Leben in ihrer Heimat und von der Sehnsucht nach einem Miteinander beider Völker berichtet.
M. ist in Deutschland aufgewachsen, hat den Fall der Berliner Mauer hier miterlebt. Jetzt lebt sie in Palästina und hofft, dass auch die Mauer um die palästinensischen Gebiete im Westjordanland
eines Tages fallen wird. „Es gibt dort Hass, Rache, Vergeltung und für beide Seiten das Wichtigste: die Vergeltung der Vergeltung“, beschrieb sie den Teufelskreis der Gewalt, in den Extremisten
beide Völker immer wieder ziehen. Die Mehrheit der Menschen sei dessen jedoch müde geworden und sehne sich nach Frieden.
„Wenn es in der Bibel heißt, wir sollen unsere Feinde lieben, habe ich mich oft gefragt: Wie macht man das?“, schilderte sie sehr persönlich. Für die christliche Minderheit (1,4 Prozent aller
Palästinenser) sei es ohnehin nicht leicht, zwischen zwei großen Weltreligionen zu leben, doch der Glaube gebe ihr Kraft. Kraft, die sie braucht, wenn sie sieht, wie sich die israelischen
Grenzanlagen durch palästinensische Felder und über Straßen schlängeln. „Man hat uns hinter diese Mauer gesteckt, sie sehen uns nicht mehr“, sagte sie, „doch 4,2 Millionen Palästinenser kann man
nicht wegdenken.“
Aus M.s Sicht sei genau das versucht worden. Seit der Gründung des Staates Israel seien die Palästinenser immer weiter zurückgedrängt worden und durch den Holocaust habe international niemand
versucht, die Israelis zu bremsen. So kam es zur Gegenwehr, die mit Gewalt beantwortet wurde und es entstand jener Konflikt, der das Land und seine Menschen bis heute prägt.

Auch wenn die Palästinenser inzwischen längst auf ein kleines Gebiet zurückgedrängt sind, wurden dort israelische Siedlungen gegründet, die mit Zäunen und eben jener bis zu neun Meter hohen Mauer gesichert sind und zum Leidwesen der palästinensischen Nachbarn 80 Prozent des Wassers abschöpften. „Sie haben blühende Gärten mit Swimmingpools – wir haben kein fließendes Wasser, sondern Wassertanks auf unseren Dächern, die viel zu oft leer sind“, schilderte M Und selbst die Olivenbäume, die für viele Menschen eine Existenzgrundlage bedeuten, würden für die Grenzanlagen gerodet. Besonders bitter aufgestoßen sei ihr das, als sie auf einem Kirchentag in Deutschland einmal gefragt wurde, ob sie nicht für Baumpflanzungen in Israel spenden wolle. Nach ihrem Hinweis auf alte Olivenbäume, die ihre Großelterngeneration gepflanzt, gehegt und gepflegt habe, sei das Gespräch sehr schnell zu Ende gewesen.
Die Verbitterung ließ sich aus M.s Worten durchaus heraushören. Viel deutlicher war allerdings ihre sehnsuchtsvolle Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden, die durch das, was vor 34 Jahren in
Deutschland ohne Blutvergießen geschehen war, genährt wird. Vor allem die älteren unter ihren zahlreichen Zuhörern an diesem Abend konnten ihre Gefühle sehr gut nachvollziehen und diskutierten
daher noch lange über den eindrucksvollen Vortrag.
In Erinnerung an diesen Abend frage ich mich nun, wie es sein kann, dass es jetzt auch bei uns wieder zu Bedrohung und Gewalt gegen Juden kommt, da wir doch in doppelter Hinsicht aus unserer
Geschichte gelernt haben sollten. Zum einen sollten wir doch gelernt haben, dass Antisemitismus und allgemein eine Verurteilung von Menschen aufgrund ihrer Religion völliger Irrsinn ist, und zum
anderen, dass wir als Zivilbevölkerung für einen friedlichen Widerstand gegen Spaltung, Hetze und Gewalt stehen können.
Zugegeben, ich halte mich hier kurz und könnte sicher noch viele Aspekte anbringen und näher beleuchten. Aber meiner Meinung nach dürfen wir schlicht nicht zulassen, dass Menschen hier bei uns
aufgrund ihrer Herkunft, Religion etc. diskriminiert und bedroht werden. Wir sollten aus unserer Geschichte gelernt haben, dass Hass nur Verlierer kennt, und jenen, die ihn schüren, kein Gehör
schenken. Krieg ist immer ein Krieg der Mächtigen, während die meisten Menschen auf beiden Seiten den Frieden wollen.
„Die können doch zur Tafel gehen“
Empörung über das Versagen von Politik
Bei X aka Twitter ging dieser Tage ein Video viral, das die Unionspolitikerin Andrea Behr bei einer Wahlkampfveranstaltung zeigt. Es gab einen Zwischenruf aus dem Publikum. Ob Kinder denn hungern sollten, wenn die CDU/CSU gegen eine Erhöhung des Bürgergeldes ist. Daraufhin sagte Behr: „Die können doch zur Tafel gehen, die sind doch tafelberechtigt.“
Dieser Satz löste Empörung aus. Bei all jenen, die für die Erhöhung sind, bei jenen, die sich mit Kinderarmut auseinandersetzen, und etlichen Menschen mehr, die eine solche Aussage als höchst
unsozial und auch als alles andere als christlich empfinden. Auch bei mir, denn ich engagiere mich auch ehrenamtlich für die Tafel, und zwar, um Menschen in Armut zu helfen, aber bestimmt nicht,
um verpfuschte Sozialpolitik auszugleichen.
Die Tafel selbst hat sich natürlich ebenfalls geäußert. „Unverschämtheit. Ehrenamtliche Angebote, für vorübergehende Notsituationen gedacht, ersetzen nicht den Staat. Dass sich die Not bei so
vielen Menschen verfestigt hat, ist auch Folge der Politik von CDU/CSU. Statt etwas zu ändern, wird widerlich abfällig über Betroffene gesprochen“, hieß es von der Tafel Deutschland e.V. und
weiter: „Wir sind eine private, spendenbasierte, ehrenamtliche Initiative. Es gibt KEINEN Anspruch auf Unterstützung. Wenn eine Tafel z.B. zu wenig Lebensmittel hat, kann sie keine Menschen neu
unterstützen, auch wenn sie die Aufnahmekriterien erfüllen würden.“

Bei der Osteroder Tafel gibt es diese Situation häufiger. Immer wieder sind Lebensmittel knapp, Familien stehen auf der Warteliste, nicht allen kann geholfen werden. Die Lebensmittel, die in den Ausgabestellen an jene Menschen ausgegeben werden, die diese Hilfe bitter nötig haben, kommen von Geschäften aus der Region, es sind Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden würden. Kommt von dort nichts, bleibt auch nichts für die Tafel.
Genau das sehen wir als unsere Aufgabe, zum einen die Hilfe für die Menschen, die sonst kaum über die Runden kommen, zum anderen die Rettung von Lebensmitteln aus Überproduktionen. Beides ist
meiner Ansicht nach eine Folge politischen Versagens. Auf der einen Seite mangelnde Umverteilung und damit Ungerechtigkeit, auf der anderen ein Konsumverhalten, das aus den Fugen geraten und
wenig nachhaltig ist.
Wenn nun jemand die Tafel als selbstverständlichen Teil eines sozialen Netzes erachtet – und anders kann ich solche Aussagen nicht verstehen – dann ist es zum einen eine politische
Bankrotterklärung und zum anderen ein Schlag ins Gesicht für alle, die dort ehrenamtliche Arbeit leisten. Wenn Frau Behr oder wer auch immer also meint, die Tafel könne in die Sozialpolitik ihrer
Partei fest eingeplant werden, dann soll sie bitte auch dafür sorgen, dass die Versorgungslücken, die wir haben, umgehend und vollständig geschlossen werden.
Gerade aus den Reihen einer angeblich christlichen Partei ist eine solche Sichtweise eine Schande und ja, wie die Tafel Deutschland sagt, eine absolute Unverschämtheit. Jede Empörung ist mehr als
angebracht und ehrlich gesagt auch darüber, dass von der Parteispitze – natürlich – keine Stellungnahme dazu kam.

Daher habe ich mich dann an die CDU hier gewandt. Die unterstützt die Tafel immer wieder, beteiligt sich auch mit Spenden. Ja, neben Lebensmitteln benötigen wir auch Geld, denn Fahrzeuge, Kühlhaus, Mitarbeiter (nicht alles geht ehrenamtlich, wenn wöchentlich Märkte und mehrere Ausgabestellen in der gesamten Region angefahren werden müssen) verursachen nun mal Kosten.
Jedenfalls wandte ich mich an die hiesige CDU-Kreistagsfraktion und bekam auch umgehend eine Antwort. „Die von Ihnen angesprochene Aussage, Betroffene „können doch zur Tafel gehen“, ruft auch
beim CDU-Kreisverband Göttingen und der CDU-Kreistagsfraktion Göttingen Unverständnis hervor“, hieß es in der Mail. Man wisse, dass die Tafeln spendenfinanziert und ehrenamtlich arbeiten und
selbstverständlich keine staatlichen Leistungen ersetzen. Na immerhin.
Weiterhin gab es sogar noch einen Hinweis auf einen Antrag im Kreistag, der besagt, dass der Landkreis einen Unterstützungsfonds für die Tafeln bereitstellen wird. Insofern war es vielleicht
sogar gut, so offensiv nachzuhaken und die Tafel damit einmal mehr ins Bewusstsein der Politik zu bringen. Das ist ohnehin oft eine gute Sache und ja letztlich auch eine Kernaufgabe von
Journalismus. Zumindest bin ich der Meinung, dass wir Journalisten uns auch immer für Schwächere und für mehr Gerechtigkeit stark machen sollten.
Geträumt und aufgewacht
Nur ein Katzensprung vom Miteinander zum Faschismus?
„I have a dream“, rief Martin Luther King vor 60 Jahren der Menge in Washington zu. Den Traum, dass eines Tages Söhne früherer Sklaven und Söhne früherer Sklavenhalter gemeinsam am Tisch der Brüderschaft sitzen werden. Den Traum, dass alle Kinder Gottes, Schwarze und Weiße, Juden und Heiden, Protestanten und Katholiken, sich die Hände reichen. Seine Rede bewegte damals die Menschen, gilt heute als ein Wendepunkt der Geschichte.
Vorausgegangen war eine strikte Trennung zwischen Schwarzen und Weißen in den USA, unter anderem auch in öffentlichen Bussen. Rosa Parks, eine farbige Bürgerrechtlerin, hatte sich einige Jahre
zuvor geweigert, im Bus von einem Platz „nur für Weiße“ aufzustehen. Dieser Akt des Protests führte zu weiterem Aufbegehren gegen die Rassentrennung und schließlich zu jener Bewegung, die Martin
Luther King entscheidend mitprägte. Nach Gesprächen mit Präsident Kennedy fuhren am 28. August 1963 schwarze wie weiße Bürger*innen in die Hauptstadt, um ihren Forderungen nach Gleichbehandlung
Nachdruck zu verleihen. Bob Dylan, Joan Baez, Mahalia Jackson und andere traten auf und eben auch Martin Luther King, der dort seine Rede hielt.
Kürzlich war ich in einem Gottesdienst, der an dieses Aufbegehren gegen Rassismus und an Pastor Martin Luther King erinnern sollte. In St. Sixti in Northeim trat ein Chor auf, der Gospels aus dem
King-Musical sang, die Predigt war von Superintendent Jan von Lingen und Mitgliedern der Gemeinde in verschiedenen Sprechrollen gestaltet. Eigentlich ja ein gewichtiges Thema, dank der Musik aber
locker präsentiert, viele in der vollbesetzten Kirche klatschten mit.

Jan von Lingen rollte die historischen Entwicklungen von damals bis hin zum Friedensnobelpreis für King und schließlich zu seiner Ermordung noch einmal anschaulich auf, schlug dann einen nicht minder ernsten Bogen zur Gegenwart. „Martin Luther King hat uns eine Aufgabe überlassen“, sagte er. Als Christen dürften wir bei Problemen wie Rassismus nicht wegsehen, müssten uns einmischen.
Er wurde nicht konkreter, doch zwischen den Zeilen war sehr deutlich, dass er sich auf politische Entwicklungen jetzt gerade hier bei uns bezog. Eine Aufgabe also, die Pflicht, mich gegen
Diskriminierung und Ausgrenzung zu stellen, wenn ich mich denn als Christ sehe. Ehrlich gesagt sprach er mir damit aus dem Herzen und seine Worte haben mich noch lange bewegt.
Alle Kinder Gottes sollen sich die Hände reichen. So einfach ist es im Grunde. Da ist kein Platz für Rassismus, nicht mal Platz für Nationalismus. Auch nicht für hetzerischen Populismus, wie er
bei uns gerade massiv um sich greift. Aber offenbar ist es nur ein Katzensprung, all die guten und richtigen Entwicklungen der vergangenen sechzig Jahre wieder rückgängig zu machen.

Dabei muss ich zum Beispiel an Nordhausen denken. Dort fand gestern die Wahl des Oberbürgermeisters statt, bei der der Kandidat der AfD mit 42,1 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis vorm parteilosen Amtsinhaber mit gerade mal 23,7 Prozent einholte. In einer Stadt mit 40 000 Einwohnern stimmt also knapp die Hälfte der Wähler für den Kandidaten einer rechten Partei, die sich mehr und mehr radikalisiert. Das finde ich durchaus besorgniserregend, auch wenn noch eine Stichwahl folgt.
Wenn wir in dieser Woche mit unserem Mordsharz-Festival in Nordhausen zu Gast sind, werde ich das wohl kaum aus dem Kopf bekommen. Vor einigen Jahren hat sich Zoë Beck beim Festival – es war kurz
vor einer Bundestagswahl – deutlich politisch geäußert, indem sie dazu aufrief, doch bitte demokratische Parteien zu wählen. Daraufhin beschwerte sich ein Paar die Veranstaltung, weil sie es
gewagt hatte, eine Wahlempfehlung auszusprechen.
Zoë ist diesmal leider nicht dabei. Dafür aber wird unter anderem Thomas Raab in Nordhausen lesen. Aus „Peter kommt später“, einem humorvollen Krimi, in dem eine alte Dame - „die alte Huber“ – in
der österreichischen Provinz ermittelt. Trotz des Humors hat das Buch auch seine ernsten Momente und besonders eine Szene, von der ich mir wünschte, der Autor würde sie lesen.
Dort heißt es: „Seine eigene Nationalität so stolz umherzutragen, so unübersehbar beflaggt durch die Gegend zu spazieren, ist ja in ihren Augen generell kein Aushängeschild sonderlicher Klugheit
oder guten Stils. Auch hier gelten die drei Steigerungsstufen: Positiv – Patriotismus, Komparativ – Nationalismus, Superlativ – Faschismus. Wobei die alte Huber selbst dem Patriotismus nichts
Positives abgewinnen kann. Von der Heimatverbundenheit zum Nationalstolz, von der stolzen Nation zur gekränkten, wütenden ist es nur ein Katzensprung.“
Ist unsere Demokratie ein Auslaufmodell??
Junge Menschen fordern politische Teilhabe
„Ich bin in einer Diktatur aufgewachsen; tretet für die Demokratie ein, denn Freiheit ist ein hohes Gut“, sagte Ali Abo-Hamoud, Geflüchteter aus Syrien und jetzt Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen in Goslar, beim Demokratietag im Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg. Der Tag wurde von Alexander Fröhlich, Jahrgang 13, initiiert und beinhaltete neben Informationsständen der demokratischen Parteien und Workshops auch eine Podiumsdiskussion mit politischen Vertretern.
Christoph Podstawa, Landesgeschäftsführer Die Linke in Niedersachsen, Andreas Körner, CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag Göttingen, Pippa Schneider, Abgeordnete der Grünen im Niedersächsischen
Landtag, René Kopka, Abgeordneter der SPD im Niedersächsischen Landtag und Florian Lillpopp, Ratsmitglied für Die Partei im Rat der Stadt Duderstadt beteiligten sich neben Abo-Hamoud an der
Diskussion. Die wurde von Alexander Fröhlich und Frank Niederstraßer geleitet und ging natürlich zunächst einmal auf die Beteiligung junger Menschen in politischen Prozessen ein.

Sie seien unterrepräsentiert, räumte Kopka ein, daher fordere die SPD das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen. Besser seien Jugendparlamente, widersprach Körner, in Göttingen gibt es dieses Modell und Jugendliche könnten so (ohne Stimmrecht) an Sitzungen teilnehmen. Allerdings reiche es nicht aus, eine Scheinbeteiligung zu schaffen, machte Schneider ihren Standpunkt deutlich.
So gab es zunächst einmal den üblichen Austausch über bestimmte Positionen der Parteien, spätestens beim Thema außerparlamentarische Opposition, sprich Letzte Generation, wurde es dann aber
lebhafter. Versagt die Politik, wenn junge Menschen auf die Straße gehen statt in die Parlamente, fragte Niederstraßer provokant und erntete damit zum Teil Verständnis für die Klimaaktivisten,
zum Teil aber auch deutliche Statements, dass Straftaten nicht der richtige Weg seien.
In einer Demokratie bestimme immer noch die Mehrheit, machte Körner deutlich, und das seien nicht Menschen, die den Verkehr aufhalten. Allerdings seien es vor allem die oberen zehn Prozent, die
das Klima schädigen, und es seien die Lobbyisten, die seit Jahren verhindern, dass Politik sich in Sachen Klimaschutz bewege, hielt Podstawa dagegen. „Die Hürden, politisch aktiv zu werden, sind
gerade hier in Niedersachsen sehr gering“, erläuterte Lillpopp dazu.
Auch beim Thema Asylrecht gingen die Meinungen weit auseinander. Während auf der einen Seite vor extrem zunehmenden Schleusertätigkeiten gewarnt wurde, mahnte die andere, sich in der
Migrationspolitik nicht von der extremen Rechten treiben zu lassen. „Nicht die Zahlen sind das Problem, sondern die Integration“, machte Abo-Hamoud seine Position deutlich, hier müssten wir noch
viel Arbeit investieren. Dagegen argumentierte Kopka, es sei schon viel Geld in die Integration geflossen, ließ allerdings offen, ob dieses Geld auch die gewünschten Ergebnisse brachte.

Viel zu schnell war die Zeit um, doch in den Workshops und im persönlichen Gespräch mit den Politiker*innen gab es für die Schüler*innen ja die Möglichkeit, einige Punkte zu vertiefen und eigene Fragen, Sorgen und Wünsche zu formulieren. Zu Beginn gab es einen Poetry Slam-Beitrag von Matti Linke, zum Abschluss einen Rap von Tscharällo, so dass deutlich wurde, dass gesellschaftliche und politische Themen auch über die Kunst angesprochen werden können.
Schulleiterin Heike Lautenbacher war sehr zufrieden mit diesem Demokratietag, verwies aber deutlich darauf, dass sie für das Gelingen viel weniger verantwortlich sei als Alexander. Der wiederum
sieht diesen Tag eher als Anfang einer Entwicklung, will sich weiterhin engagieren, zum einen im politischen Geschehen in Herzberg, zum anderen vielleicht auch, um weitere Veranstaltungen für
junge Menschen und eben für die Demokratie auf den Weg zu bringen.
Auf dem Heimweg von diesem Pressetermin gingen mir viele Gedanken durch den Kopf. Ja, es gab die typischen Worthülsen und einige Statements, denen ich gerne widersprochen hätte. Insgesamt aber habe ich eine lebhafte, authentische und nachklingende Diskussion erlebt. Demokraten, die unterschiedlichste Meinungen habe, aber sich darüber austauschen, so dass die Schüler*innen sich am Ende ein eigenes Bild machen können. So soll es doch sein, oder?
Am meisten hat mich beeindruckt, dass all das von einem Schüler, also Alex und sicher ein paar anderen in seinem Umfeld ausging. Diese junge Generation möchte sich mit Politik auseinandersetzen. Sie möchte gehört werden, sie möchte beteiligt werden, sie möchte, dass unser System der Demokratie eben nicht von Populisten und anderen Kräften außer Kraft gesetzt wird. Da das offenbar die Mehrheit der jetzt Jugendlichen ist, denke ich, es lohnt sich in jedem Fall, für diese Demokratie zu kämpfen, damit sie eine Zukunft in Freiheit haben.
Presse vs. Populismus
Die Letzte Generation und ich - Teil 3
Ja ich war motiviert. Wollte Leute zum Nachdenken bringen. Wollte meinen Job als Journalist ernst nehmen und Fakten und differenzierte Meinungen dem Populismus gegenüberstellen. Nahm mir vor, viele dumme Argumente zu entkräften. Und ja, diese dummen Argumente kamen.
Auf Youtube postete jemand sofort nach Erscheinen des Videos etliche kopierte Texte, die der Letzten Generation nachweisen sollten, wie schlimm sie doch ist. Auf Facebook hagelte es seltsame
Beschimpfungen, überwiegend von Leuten, bei denen ich den Eindruck hatte, sie haben weder den Text gelesen, noch das Video angesehen.
Zuerst antwortete ich noch auf jeden einzelnen Kommentar, doch irgendwann gab ich auf. Zugegeben, es gab auch einige, die sagten, es habe sie zum Nachdenken gebracht und sogar jemanden, der
berichtete, er habe bei einer Straßenblockade angehalten, die Festgeklebten mit Wasser versorgt und andere Autofahrer besänftigt. Das hat mich dann doch beeindruckt.
Größtenteils aber waren es nachgeplapperte Parolen, bei denen ich den Eindruck hatte, diese Menschen wollen gar nicht weiter nachdenken. Es fühlte sich also an wie der sprichwörtliche Kampf gegen
Windmühlen. Und irgendwann schoss mir der Gedanke durch den Kopf: dann macht doch alle weiter wie bisher und lasst eure Kinder und Enkel verrecken.

Ja, ich muss gestehen, dass mich all das mürbe gemacht hat. Hinzu kam später noch der Vorwurf, ich hätte mich in den vergangenen Jahren zu viel um D., F. und ihre Kinder gekümmert. Auch jene Parolen gegen die angeblich so gefährlichen Flüchtlinge und die ach so bösen Ausländer in unserem Land machen mich mürbe. Vor allem eben, weil diese Meinung ja inzwischen wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein scheint.
Lohnt es überhaupt noch, für das Gute zu kämpfen? Hat der Populismus nicht längt gewonnen? Bringt es noch was, sich in unserer Gesellschaft für Toleranz, Akzeptanz und unsere Demokratie
einzusetzen? Momentan bin ich mir da echt nicht so sicher, sorry. Auf jeden Fall hab ich gerade keinen Bock mehr. Ich bin raus.
Aktivisten vs. Autofahrer
Die Letzte Generation und ich - Teil 2
Einige Tage später traf ich mich mit Basti in der Stadt zu unserem Interview. Er sprach über seine Motivation, die natürlich aus einer aus seiner Sicht gefährlichen Passivität der Bundesregierung in Sachen Klimaschutz resultiert, außerdem räumte er ein, dass er den Unmut vieler über die Form des Protests der Letzten Generation verstehen könne. Es sei ja auch nicht ihr Ziel, den einzelnen Autofahrer zu treffen, sondern die Politik wachzurütteln. All das klang für mich durchaus nachvollziehbar.
Am meisten beschäftigt hat mich seine Aussage, dass er jedes Mal Angst habe, sich auf die Straße zu kleben. Angst vor Gewalt, Angst davor, dass irgendwann jemand nicht mehr bremst. Immerhin gab
es ja schon etliche Situationen, in denen genervte Verkehrsteilnehmer Selbstjustiz übten oder eben auch einfach auf die Aktivisten draufhielten. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis es wirklich
eskaliert?
Hier jedenfalls ist mein Pressetext mit dem ungekürzten Interview:
„Es ist offensichtlich, dass unsere jetzige Lebensweise unsere Lebensgrundlage nachhaltig zerstört“, sagt Bastian. Er ist Mitglied der Letzten Generation und hat sogar sein Studium in
Göttingen unterbrochen, um auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen.
Aus seiner Sicht läuft die Klimapolitik der Bundesregierung ziemlich schief, die Emissionen steigen weiter, das Bundesverfassungsgericht hat sogar entschieden, dass bestimmte Gesetze sogar
verfassungswidrig sind. Darauf möchten er und die Letzte Generation aufmerksam machen, das ist der Grund, warum Bastian und andere sich unter anderem auf Straßen kleben, um Aufmerksamkeit zu
erregen.

„Wenn ich auf die Straße gehe und mich dort festklebe, dann weiß ich, dass es eine Straftat darstellen kann“, erläutert er die Methoden, „aber wir stehen mit Namen und Gesicht dazu, was wir tun und entziehen uns auch nicht der Justiz.“ Das erste Mal auf die Straße geklebt hat er sich im vergangenen Herbst in Berlin, erzählt er, er habe damals wie heute Angst davor, Angst vor der Gewalt, davor, dass er angespuckt und getreten wird, wie er es schon erlebte, und auch Angst davor, dass irgendwann einmal ein Fahrzeug eben nicht bremst, sondern einfach weiterfährt.
Adressat sind für ihn und andere Aktivist*innen eindeutig die Verantwortlichen in der Politik, die sich trotz Protesten von Fridays for Future und anderen nicht an ihre eigenen Gesetze sowie
das Pariser Klimaabkommen hält. Dies wird viel Leid für unzählige Menschen auf der Welt nach sich ziehen, so seine Auffassung, insbesondere für nachfolgende Generationen, so dass jetzt dringend
etwas passieren muss.
Ob es richtig ist, dies mit allen gewaltfreien Mitteln durchzusetzen, darüber kann und muss diskutiert werden. Für Bastian ist es richtig, weil alle anderen Formen des Protests nichts gebracht haben und seine Generation die letzte ist, die noch etwas tun kann. Für andere sind die Blockaden auf den Straßen vor allem ein Ärgernis. „Protest ist nicht schön“, sagt Basti dazu, er soll ja stören und aufrütteln.
Soweit also der Pressetext, der mich im Nachhinein doch nachdenklich machte. Bei mir hat er eindeutig für mehr Verständnis für die „Klimakleber“ gesorgt, weil ich jetzt nachvollziehen kann, was
sie antreibt. Ebenso war mir aber auch klar, dass eine solche Veröffentlichung einige Kommentare nach sich zieht, vor allem eben nicht nur zustimmende.
Darauf war ich vorbereitet, nahm mir fest vor, sie auf meinem Youtubekanal, aber auch auf der Facebookseite des Eseltreiber, wo zumindest der Link zum Text und zum Interview erscheinen würde,
alle zu beantworten. Das gelang mir letztlich nicht, doch dazu gibt es erst demnächst mehr.
Fortsetzung folgt...
Klimaschutz vs. Kultur
Die Letzte Generation und ich - Teil 1
Als damals die Meldung in allen Medien auftauchte, Klimaaktivist*innen hätten Tomatensuppe auf ein Van Gogh-Gemälde geworfen, war ich entsetzt. Klar, Klimaschutz ist wichtig und geht uns alle an. Bei Protestmärschen von Fridays for Future war ich dabei und habe berichtet, ebenso als Extinction Rebellion sich vors Rathaus kettete. Aber bei der Zerstörung von Kunst hörte meine Solidarität definitiv auf.
Nun könnte ich erzählen, dass mir auch die – wohlgemerkt neutral geschriebenen – Artikel über Fridays for Future oder Extinction Rebellion schon Kritik einbrachten, aber das ist eine andere
Geschichte. Auf jeden Fall habe ich zu Klimaaktivist*innen eine klare Meinung, nämlich eine sehr positive. Es ist wichtig, die Bevölkerung und vor allem die Politik immer wieder an die Probleme
zu erinnern, schließlich geht es um nicht weniger als unsere Zukunft.
Immerhin sehe ich inzwischen selbst bei uns die Auswirkungen von besorgniserregender Trockenheit und in immer kürzeren Abständenauftretenden Jahrhundertstürmen und so weiter. Der Harz ist
verglichen mit dem Zustand vor einigen Jahren nicht wiederzuerkennen, die Ausbreitung des Borkenkäfers eindeutig auf die viel zu trockene Sommer zurückzuführen, zudem haben Stürme immer wieder
Bäume auf riesigen Flächen abknicken lassen, weil die Böden einfach keinen Halt mehr bieten. Eindeutig Folgen der Monokultur, ja, aber eben auch des Klimawandels, wie Experten sagen. Ich sehe
also live und in Farbe, was wir gerade mit unserer Welt machen.

Andererseits gehöre ich nun mal der schreibenden Zunft an, liebe Literatur, räume der Kunst den höchsten Stellenwert menschlicher Kultur ein. Ohne Kunst, ohne kreatives Schaffen wären wir nicht dort, wo wir heute sind.
Das klingt jetzt alles so unglaublich ernst und ist es ja im Grunde auch. Was ich aber sagen will, ist, dass die Kunst für mich letztlich auch das ist, was uns als Menschen ausmacht. Es sind
Kultstätten und religiöse Bauten, die über Jahrhunderte unsere Ehrfurcht vor Gott bekunden, es sind Malereien und Literatur, die unsere Kultur prägten und uns von der Antike über die Aufklärung
bis in die heutige Zeit brachten, und ja, es sind auch Anime oder Videospiele, die uns zeigen, dass wir ab und zu der Realität entfliehen müssen, weil wir sie sonst nicht ertragen können. All das
finde ich überlebensnotwendig.
Wenn nun also Klimaaktivismus und Kunst kollidieren, sehe ich das als Problem und im Falle der Farbattacken auf Bilder eindeutig als eine Form des Protests, die zu weit geht. Gut, hinterher kam
dann raus, dass die Gemälde hinter Glas waren und die Aktivist*innen das wussten. Das relativiert meine Ablehnung ein wenig, aber nicht vollkommen.

Noch etwas später machte die Letzte Generation dann ja von sich reden, indem sie sich auf Straßen klebten und den Verkehr kurzfristig zum Erliegen brachten. Auch das fand ich nicht wirklich gut, vor allem nicht, da es ja Medienberichte über im Stau stehende Rettungswagen und vieles mehr gab. Trotzdem war ich mir in diesem Fällen schon nicht mehr ganz so sicher, ob das nicht doch eine Form des zivilen Ungehorsams ist, der die Regierung endlich dazu bringen kann, sich wirklich mit Maßnahmen gegen den Klimawandel und die Einhaltung der eigenen Versprechen zu befassen.
Vor allem waren es diejenigen, die am lautesten gegen die Letzte Generation wetterten, die mich immer wieder dazu brachten, mich mit deren Protestformen auseinanderzusetzen. Es waren Konservative
und Rechte in der Politik, populistische Medien und eben auch Klimaleugner*innen, die allen nur erdenklichen Blödsinn über die Aktivist*innen in die Welt setzten.
Aus alldem erwuchs mein Wunsch, endlich mal selbst mit einem Mitglied der Letzten Generation zu sprechen. Also schrieb ich eine Mail und bekam wenige Tage später einen Anruf von Basti. Er ist
Student in Göttingen, erzählte er, habe sein Studium aber gerade auf Eis gelegt, um sich auf die Straße zu kleben. So sagte er es natürlich nicht, es trifft aber den Kern. Auf jeden Fall eine
interessante Gelegenheit, mehr zu erfahren, so dass ich ein Interview mit ihm vereinbarte.
Fortsetzung folgt...
Positive Nachrichten machen glücklicher
Konstruktiver Journalismus - Teil 2
Einer, der es ausprobiert hat, nur noch positive Nachrichten zu konsumieren, ist der Youtuber Joseph DeChangeman. Einen Monat lang, mit der Kamera dokumentiert. Er habe anfangs Sehnsucht nach Drama gefühlt, berichtet er, musste umlernen, um nicht gelangweilt zu sein. Doch schon nach zwei Wochen habe sich das geändert. „Ich fühle mich hoffnungsvoller mit Blick auf alles“, sagt er, „dankbarer für das, was ich habe, und insgesamt glücklicher.“
Auf dieses Video wiederum haben Oliver Dombrowski und Florian Diedrich alias Doktor Froid in ihrem Stream reagiert. Beide setzen sich auch immer wieder mit Medienthemen auseinander, Florian
insbesondere auf seinem Youtubekanal LeFloid. Sie waren zunächst begeistert vom Experiment, dann allerdings entwickelt sich zwischen beiden eine äußerst interessante Diskussion.

„Was ich zu wenig bedacht finde, ist die Aussage über die Welt. ‚Die Welt wird besser, die Welt wird friedlicher, die Welt wird demokratischer...‘“, merkt Flo an, „Aber in unserer Lebensrealität haben wir mit diesen Dingen, die sich in der Welt verbessern, wenig zu tun. Für uns als ‚absolut überprivilegierte Bewohner der ersten Welt‘ spielen andere Dinge eine Rolle.“ Was er meint, ist, dass die Lebensumstände bei uns hier gerade für viele Menschen gefühlt deutlich schlechter werden, wodurch die Sicht auf die Welt eben eine deutlich kritischere ist.
Olli hält dagegen, die weltweiten Fakten seien aber eindeutig, dass vieles sich nun einmal in den letzten Jahrzehnten deutlich zum Guten entwickelt habe. Ja, aber es seien eben vor allem jene
Punkte, die in unserer Gesellschaft schon länger keine Rolle mehr spielen, weil wir Kindersterblichkeit, Hunger, diktatorische Machtstrukturen, Ausbeutung durch Kolonialisierung und vieles andere
größtenteils überwunden haben oder es hierzulande nie ein Problem war, so Flo. Für viele Menschen hier sinkt der Lebensstandard in den letzten Jahren gefühlt oder auch tatsächlich.
Es ist also immer auch eine Frage von Blickwinkeln, so stellen beide fest. Unter anderem auch ein Grund, warum so viele Menschen für populistische Wahlversprechen empfänglich sind. Global gesehen
wird faktisch vieles besser, hier bei uns in Deutschland fühlen sich viele mit den Herausforderungen und Forderungen des Klimawandels überfordert, von der Energiekrise und steigenden Preisen
verunsichert und vom Krieg in der Ukraine verängstigt. Es liegt an uns, welche Perspektive wir einnehmen bzw. an den Medien, welche sie uns zeigen.
Großes Potenzial für konstruktiven, also positiven Journalismus gibt es nicht nur auf den speziellen Plattformen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben und die Joseph getestet hat, sondern auch in der lokalen Presse. Vor Ort zeigen die Krisen der Welt natürlich Auswirkungen, bestimmen aber selten den Großteil des Alltags. Vielmehr sind es kleinere Nachrichten, solche, die vielleicht über die Region hinaus kaum relevant sind, die Menschen aber dennoch bewegen.
Engagiertes Ehrenamt, das Dinge am Laufen hält, Feste und Kultur, die jetzt nach der Durststrecke der Pandemie wieder stattfinden können, einzelne Menschen, die Besonderes leisten und kleine
Neuerungen, die Kindern, Senioren, Geflüchteten oder anderen guttun. Vor Ort passieren diese Dinge und haben die Chance, zur Nachricht zu werden.
Das ist konstruktiver Journalismus, der uns hilft, auch das Positive in der Welt zu sehen. Daran arbeite ich seit Jahren, das ist mein täglicher Job. Und ja, ich schreibe viel lieber über Menschen, die mich beeindrucken, über Entwicklungen, die ich positiv finde, über die kleinen Begebenheiten des Alltags, die anderen helfen können. Das will und werde ich auch weiterhin tun, eben aus voller Überzeugung. Trotzdem werde ich euch hier die eine oder andere Meckerei über das, was mich da draußen aufregt, nicht ersparen. So ist nun mal das Leben. Es bringt täglich Positives und Negatives mit sich.
Schlechte Nachrichten machen krank
Konstruktiver Journalismus - Teil 1
„Nachrichten gucke ich gar nicht mehr, das ist mir zu grausam, was heute alles in der Welt passiert.“ Diesen Satz habe ich in den letzten Jahren immer häufiger gehört. Aus einem ersten Impuls heraus will ich dann immer antworten: Wenn du die Nachrichten nicht schaust, passieren die schlimmen Dinge aber trotzdem. Selbst wenn die Medien nicht über Kriege, Katastrophen und Ungerechtigkeiten berichten, macht das die Welt leider kein Stück besser.
Sicher, es ist die Pflicht von Journalisten, über das zu berichten, was in der Welt passiert. Aber passieren denn wirklich nur schlimme Dinge? Passieren in der Welt mehr negative Dinge als
positive? Vielleicht schon, das weiß ich nicht, doch auf jeden Fall nicht in dem Maße wie es sich in den täglichen Nachrichten widerspiegelt. Also könnten die Medien somit doch einen Einfluss
darauf haben, wie wir die Welt wahrnehmen und letztlich darauf, wie wir uns in dieser Welt fühlen.

Wenn uns Medien immer wieder unterschwellig sagen, dass die Welt schlecht ist und wir nichts dagegen tun können, macht uns das passiv, unsicher und ängstlich. Bekommen wir aber gezeigt, dass wir etwas tun können, bewirkt das bei uns im Gehirn, dass wir uns lösungs- und zukunftsorientierte Fragen stellen und aktiv werden. So sieht es jedenfalls die Neurowissenschaftlerin Prof. Dr. Maren Urner, die zum Thema Informationsverarbeitung und konstruktiver Journalismus forscht und auch Bücher zum Thema veröffentlichte.
Doch was genau bedeutet eigentlich konstruktiver Journalismus? Es sind platt gesagt Nachrichten, die nicht nur ständig den Weltuntergang prognostizieren, sondern Wege darstellen, mit Krisen und
Herausforderungen fertig zu werden, also die Frage stellen, wie es weitergehen kann. Vor allem in der Anfangszeit der Pandemie wurde das auch in großen Redaktionen immer populärer, weil Leser,
Hörer, Zuschauer irgendwann keine neuen Schreckensmeldungen mehr wollten.
Bei Nachrichten, die veröffentlicht werden, spielt (ganz theoretisch) eine Rolle, welche Relevanz sie haben, ob es eine Neuigkeit ist, ob die Information einen Nutzen hat und auch, ob es Menschen
bewegt. Dabei sollen Journalisten kritisch sein, keine Frage, außerdem klicken sich Schreckensmeldungen nun mal besser als andere. Gerade Letzteres sorgt dafür, dass Schlagzeilen (ganz platt
ausgedrückt) immer reißerischer und angsteinflößender werden.

„Studien bestätigen, dass Medien häufig die Welt als einen schlechten Ort darstellen“, sagt der Journalist Mirko Drotschmann im Medienmagazin „Zapp“. Dies führe dazu, dass manche Menschen bestimmte Sachverhalte negativer einschätzen, als sie in der Realität sind. Außerdem verursache der Konsum solcher Nachrichten bei uns Stress. Das bestätigen ja auch die Forschungen von Maren Urner.
Ist konstruktiver Journalismus denn nun die Lösung? Ja, sagt Drotschmann, eine Studie zeige, dass Nachrichten für einige so wieder attraktiver werden, dass sich die Nutzungsdauer erhöht und es
weniger Hasskommentare gibt.
Fortsetzung folgt...
Spitzenverdiener unter den Abgeordneten
Nebeneinkünfte unserer regionalen Bundestagsabgeordneten
Abgeordnete im deutschen Bundestag dürfen Nebentätigkeiten nachgehen und somit zu ihren Diäten ein Zusatzeinkommen beziehen. Allerdings müssen diese Einkünfte offengelegt werden, das gilt zumindest seit der sogenannten „Maskenaffäre“ der CDU/CSU, die einen neuen Gesetzesentwurf nach sich zog.
Jetzt, zwei Jahre später gab es eine große Recherche vom Spiegel und Abgeordnetenwatch.de, die diese Nebeneinkünfte aller Abgeordneten veröffentlichte. Dabei ist von Verbindungen in die
Wirtschaft die Rede, die „problematisch“ sein könnten, außerdem seien einige Veröffentlichungen immer wieder verschleppt worden, so dass die Transparenz lange nicht so eindeutig gewesen sei, wie
es sich auf dem Papier anhörte.
Jetzt allerdings sei alles bis auf wenige Ausnahmen einsichtig, so dass es sogar eine „Bestenliste“ mit denjenigen Abgeordneten gab, die am meisten nebenher verdienen. Sebastian Brehm von der CSU
steht mit 3 447 584 verdienten Euro seit der Bundestagswahl 2021 an der Spitze, gefolgt von Alexander Engelhardt, ebenfalls CSU, mit 2 069 780 Euro.

Auf Platz sechs folgt der Göttinger Abgeordnete Fritz Güntzler (CDU) mit 693 381 Euro. (Wie ihr vielleicht wisst, lebe ich am Harz im Landkreis Göttingen. Also blicke ich natürlich in diesem Text, den ich übrigens nicht zuerst für diesen Blog, sondern als lokalen Presseartikel verfasst habe, auf unsere Region. Das könnt ihr für eure Wahlkreise aber auch tun, der Link folgt später.)
Güntzler ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Göttingen, die Einkünfte stammen zum Großteil aus der Gewinnausschüttung zweier Kanzleien. Daraufhin habe ich ihn zum Thema Nebeneinkünfte
befragt, wollte wissen, ob er es für gerechtfertigt halte, dass Politiker so viel nebenher verdienen dürfen, ob es aus seiner Sicht eine Obergrenze geben sollte und auch, warum auf den
Spitzenpositionen die konservativen und rechten Parteien am häufigsten vertreten sind.
Direkt antwortete er nicht auf die Fragen, betonte aber, er sei mit Leib und Seele Abgeordneter und sich der damit verbundenen Verantwortung bewusst. „Neben meinem Bundestagsmandat arbeite ich,
soweit mir dies zeitlich möglich ist, in meinem Beruf als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Die Wahrnehmung meines Bundestagsmandats steht jedoch immer im Vordergrund.“

Er arbeite durchschnittlich weit über 60 Stunden in der Woche, führte er aus, freie Abende seien eher der Ausnahmefall. Da sein politisches Mandat nur eines auf Zeit sei, müsse er in seinem Berufszweig „am Ball“ bleiben, ein Wiedereinstieg müsse jederzeit möglich sein. „Meine beruflichen Kenntnisse helfen mir aber auch bei der Arbeit im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages“, so Güntzler weiter, durch die Arbeit in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung habe er ein besseres Gefühl dafür, welche Themen die Bürger und Unternehmen akut bewegen.
„Nur ein geringer Anteil der Gewinnausschüttungen beruht auf meiner tatsächlichen Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in den Kanzleien. Der weitaus größte Teil ergibt sich aus der
Kapitalbeteiligung, vergleichbar mit einer Dividendenzahlung auf eine Aktie. Die Höhe der Gewinnausschüttung lässt somit keinen Rückschluss auf den jeweiligen zeitlichen Umfang der Tätigkeit zu“,
führt er aus.
Die Veröffentlichungen von Spiegel und Abgeordnetenwatch.de beinhalten auch eine Aufschlüsselung sämtlicher Politiker aus den Regionen und deren Nebeneinkünfte. Im Wahlkreis Goslar – Northeim –
Osterode sind es Frauke Heiligenstadt (SPD) mit 0 Euro sowie Karoline Otte (Grüne) mit ebenfalls 0 Euro. Im Wahlkreis Göttingen Jürgen Trittin (Grüne) mit 0 Euro, Konstantin Kuhle (FDP) mit 7 492
Euro und eben Fritz Güntzler mit 693 381 Euro.
Die interaktive Karte findet ihr hier: Abgeordnetenwatch.de.
Sterben geht uns alle an
Der Wert einer Gesellschaft - Teil 3
„Wir sind Sterbliche, die darum wissen, dass sie sterblich sind.“ So begann Dr. Heinz Rüegger seinen Vortrag zum Thema „Selbstbestimmtes Sterben“. Während wir aber über Jahrhunderte den Tod als Schicksal angesehen haben, also als etwas, dem wir uns ergeben müssen, haben wir durch die moderne Medizin gelernt, dass wir ihn hinauszögern können. Wenn nun das Sterben beeinflussbar ist, dann erfordert das von uns Entscheidungen.
Um genau diese Entscheidungen ging es in diesem dritten Teil einer Reihe, die Pastorin Ute Rokahr für den Kirchenkreis Harzer Land organisiert hatte. Dafür dankte ihr Superintendentin Ulrike
Schimmelpfeng herzlich. Den Impulsvortrag des Theologen, Ethikers und Buchautors Heinz Rüegger bezeichnete sie anschließend als den vielleicht wichtigsten der Reihe, da das Sterben eben uns alle
angeht und sich die Entscheidung, wie es stattfinden soll, nicht wegdrücken lässt.
Es ist also zum einen die Möglichkeit, den Tod hinauszuzögern, zum anderen aber, wenn wir es selbst ein Stück weit in der Hand haben, eben „die letzte Aufgabe in unserem Leben“. Die Mehrheit der
Menschheit sterbe heute nach einer Entscheidung, den Tod zuzulassen, so Dr. Rüegger. Diese Entscheidung solle niemand anderes fällen als der Patient selbst.

Es sei nicht weniger als ein kulturgeschichtlicher Paradigmenwechsel, wenn wir den Tod als beeinflussbar begreifen, eine Ausweitung unserer moralischen Verantwortung. Wir müssten uns mit dieser Frage auseinandersetzen, weil unser Gesundheitssystem nun einmal zu gut sei. „Die Frage ist nicht, ob wir das gut finden oder nicht; es ist einfach so“, stellte er heraus.
Aber dürfen wir aus christlich-moralischen Gesichtspunkten eigentlich selbst entscheiden? Steht es nicht Gott zu? Das Leben sei ein Geschenk Gottes, postulierte er, ein Geschenk, mit dem wir
verantwortlich umgehen müssen. Ebenso gab uns Gott aber auch die Freiheit und Möglichkeit zu Wissenschaft, also letztlich die Fähigkeit, ins Leben eingreifen zu können. Daher sei es unsere
Eigenverantwortung, wie lange wir unter bestimmten Umständen an diesem Geschenk festhalten wollen.
Zum selbstbestimmten Sterben gehöre nicht nur der assistierte Suizid, führte er aus, sondern unter anderem auch der Therapieverzicht, das Sterbefasten oder die Verweigerung lebensverlängernder
Medikamente. „Ich bin der Meinung, dass all diese Formen grundsätzlich legitim sein können“, mache er deutlich. Aus theologischer und ethischer Sicht spreche nichts dagegen, auf ein für uns
unerträgliches Leben zu verzichten.

Das Problem sei, dass wir lernen müssen, rechtzeitig ins Sterben einzuwilligen. Es ist also wichtig, frühzeitig den Willen zu formulieren, darüber auch mit Familie, Freunden oder dem Arzt oder der Ärztin zu sprechen. Bei einer Lungenentzündung in hohem alter kann der Verzicht auf lebenserhaltende Medikamente ein guter Weg sein, so Dr. Rüegger, sein Wunsch sei übrigens ein Nierenversagen, das es ihm erlaubt, rechtzeitig und vor allem ohne großes und langes Leiden zu gehen. Das sagte er angesichts einer Krebsdiagnose vor einigen Jahren, die ihn selbst auch dazu brachte, mit seiner Frau alle Möglichkeiten durchzusprechen.
„Es ist ein sanftes Sterben und etwas anderes ist möglicherweise wesentlich weniger angenehm“, sagte er deutlich. Die meisten Menschen wollen ja ohne langes Leiden sterben, nur müssten sie sich
dafür eben selbst entscheiden und es auch zulassen. Es gehöre Mut dazu und innere Ruhe, um sich der Entscheidung bewusst zu werden. Außerdem könne sich diese Entscheidung aufgrund äußerer
Umstände im Leben ändern, doch letztlich liege sie eben immer bei jeder und jedem einzelnen, nicht beim Arzt, bei Pflegenden oder Angehörigen.
Somit sei Sterben für ihn somit eine Balance zwischen Zulassen und Selbstbestimmung, die uns alle betrifft. „Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, diese Balance für sich zu finden“, schloss
er, bevor mit den Zuhörerinnen und Zuhörern noch lange, intensiv und zum Teil sehr persönlich diskutiert wurde.
Selbstbestimmungsrecht vs. Lebensschutz
Der Wert einer Gesellschaft - Teil 2
Der Paragraph 217 des Strafgesetzbuches, in dem es um die Förderung der Selbsttötung geht, wurde Anfang 2020 vom Bundesverfassungsgericht gekippt, weil dieses die Beihilfe zum Suizid, also das selbstbestimmte Sterben nicht als Straftat sieht. Seitdem wird über die Freiheit, sich das Leben zu nehmen rechtliche, politisch, ethisch und auch theologisch kontrovers diskutiert.
Dr. Dorothee Arnold-Krüger vom Zentrum für Gesundheitsethik an der evangelischen Akademie Loccum war am Montag im Kirchenkreis Harzer Land in Osterode zu Gast, um über die kirchlichen Positionen
zum assistierten Suizid zu sprechen. Pastorin Ute Rokahr und Superintendentin Ulrike Schimmelpfeng hatten sie eingeladen und setzten damit die Reihe fort, die mit einer Veranstaltung mit Prof.
Dr. Friedemann Nauck zu den medizinischen Aspekten begann.
„Es war ein Paukenschlag“, sagte Dr. Arnold-Krüger über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, zum einen, weil es sogar live im Fernsehen übertragen wurde, zum anderen, weil es die Debatte um
den assistierten Suizid erst richtig ins Rollen brachte. Die Referentin machte erst einmal deutlich, dass zwischen der Hilfe beim Sterben und der Hilfe zum Sterben unterschieden werden müsse, wie
es auch schon Prof. Dr. Nauck erläutert hatte.

Die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland untersagt, der §217, der erst 2015 eingeführt worden war, regelte die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, die damit unter Strafe gestellt wurde. Seit 2020 arbeitet der Bundestag an einer Neuregelung, für die es bisher mehrere Entwürfe gibt, die sich in einigen Punkten unterschieden, darunter auch die Forderung einer Wiedereinführung von §217. „Wie der Bundestag sich entscheiden wird, ist derzeit noch offen“, vermutete Dr. Arnold-Krüger.
Letztlich sei es schwer, die Moralvorstellungen, die innerhalb einer Gesellschaft auseinandergehen, in ein für alle gültiges Gesetz zu fassen. Das Recht, so sagte sie, müsse immer einen größeren
Rahmen umfassen als die Moral. Damit ist man bei einer ethischen und auch theologischen Diskussion angekommen. Auch innerhalb der evangelischen Kirche gibt es hierzu verschiedene Positionen, die
sie im Folgenden skizzierte.
Über allen steht letztlich die Frage, was Vorrang hat, das Selbstbestimmungsrecht oder der Lebensschutz. Die Unantastbarkeit des Lebens stellt für uns ein hohes Gut dar, ebenso aber die
Menschenwürde und die Entscheidungsfreiheit des Individuums. Einige Theologen argumentieren damit, dass das Leben als Gabe der Schöpfung anzusehen und somit unantastbar ist, auch für den
einzelnen. Daher sei der assistierte Suizid abzulehnen, so ihre Schlussfolgerung.
Andere, zu denen auch der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zählt, argumentieren mit der Auferstehung, die uns vom Tod erlöst. „Nach wie vor ist
Sterbebeistand, nicht Sterbehilfe die Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten“, sagte Huber, der in einem Artikel der FAZ auch die Frage aufwarf, ob unser Leben denn als eine Gabe oder als Besitz
anzusehen sei.

Vertreter der liberalen Theologie vertreten die Auffassung, dass Gott uns Individualität und Subjektivität garantiere, die Freiheit der Lebensgestaltung also gegeben sei und das Leben somit keine Pflicht. Es gebe somit Situationen, in denen das Leben nicht mehr lebenswert ist und kein Aushalten verlangt werden dürfe.
Durch ihre Ausführungen machte Dr. Arnold-Krüger deutlich, wie sensibel dieses Thema ist und dass es letztlich in der Bewertung immer vom Einzelfall also vom jeweiligen Betroffenen abhänge. Das
macht eine allgemeine Gesetzgebung nicht eben einfacher und die Diskussion darüber so langwierig. Könnte begleiteter Suizid nicht auch eine kirchliche Aufgabe sein? Könnte die Diakonie nicht in
solche Prozesse eingebunden werden?
Auch dazu gibt es keine eindeutigen Positionierungen, die Einrichtungen müssen ihre Entscheidungen selbst treffen. Doch können die Träger überhaupt ablehnen, dass beispielsweise Vertreter von
Sterbehilfeorganisationen in ihre Häuser kommen? „Wir helfen beim Sterben, aber nicht bei der Selbsttötung“, formulierte dazu die Diakonie Wuppertal.
Der Dialog in diesen Fragen ist wichtig, betonte die Referentin noch einmal, bevor sie sich selbst in den Dialog mit ihren Zuhörerinnen und Zuhörern begab. Es gab viele Fragen, viele Anmerkungen
und am Ende dieses spannenden Abends wenig eindeutige Antworten, eben weil es ein komplexes Themenfeld ist.
Fortsetzung folgt...
Existenzielle Gedanken zum Lebensende
Der Wert einer Gesellschaft - Teil 1
"Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt", hat der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann einmal gesagt. Die schwächsten Glieder sind die Kinder, die Kranken und die Alten. In unserem Kirchenkreis gibt es derzeit eine Vortragsreihe zum Thema Tod, Sterben und Sterbehilfe. Auch dabei geht es um die Schwächsten und ich frage mich, was unser Umgang mit jenen, die kurz vor ihrem Lebensende stehen, über uns aussagt.
Hier meine Pressetexte zu diesen Veranstaltungen, den Anfang machte Prof. Dr. med. Friedemann Nauck von der Klinik für Palliativmedizin der Georg-August-Universität Göttingen:
Seelsorge und Medizin greifen in der Frage nach dem Lebensende ineinander, erläuterte Prof. Dr. Friedemann Nauck bei seinem Vortrag zum ärztliche assistierten Suizid in der Osteroder Stadthalle. Heilen funktioniere nun einmal nicht immer, daher sei das Trösten und Lindern in der Palliativmedizin und in der Hospizarbeit so wichtig.
Damit war dann auch klar, warum diese Veranstaltung vom Kirchenkreis Harzer Land angeboten wurde. Es sei ein anspruchsvolles Thema, zu dem sich jeder eine individuelle Meinung bilden sollte, das aber auch gesamtgesellschaftlich diskutiert werden muss, sagte Superintendentin Ulrike Schimmelpfeng eingangs. Pastorin Ute Rokahr, die vor allem in der Altenseelsorge tätig ist und daher auch Professor Nauck gut kennt, stellte den Gast den zahlreichen Zuhörer*innen in der Stadthalle vor und überließ ihm dann die Bühne.
Der missverständliche Begriff der Sterbehilfe, so führte dieser aus, müsse zunächst einmal in zwei Aspekte unterschieden werden, zum einen die Hilfe beim Sterben, zum anderen die Hilfe zum Sterben. Ersteres bezeichnet die Begleitung am Lebensende, zweiteres beinhaltet die Tötung auf Verlangen, also den assistierten Suizid. Die aktive Sterbehilfe ist bei uns verboten (§ 216 StGB), die Beihilfe zur Selbsttötung, also die Bereitstellung von Mitteln zum Suizid ist nicht strafbar, widerspreche aber dem ärztlichen Ethos.

Dagegen sei die indirekte Sterbehilfe, also die Lebensverkürzung als Nebenwirkung einer palliativmedizinischen Maßnahme zulässig. Es gehe hier um das Zulassen des Sterbens und das Beenden lebensverlängernder Maßnahmen. Diese Differenzierung sei medizinisch, juristisch und auch ethisch wichtig, betonte Prof. Nauck.
Lange durften Ärzte nicht assistieren, inzwischen kann der assistierte Suizid in Einzelfällen durchgeführt werden. Er selbst erlebe es immer wieder, dass Menschen in der Palliativstation aufgenommen werden, die die Assistenz beim Suizid verlangen. Er verweigere, weil es aus seiner Sicht andere Wege gibt. "Keiner dieser Menschen ist bisher in die Schweiz gefahren", berichtete er aus seiner Erfahrung.
Menschen möchten möglichst wenig Schmerzen und Beschwerden haben, möchten, dass offen mit ihnen gesprochen wird, möchten dass ihre Wünsche auch dann berücksichtigt werden, wenn sie selbst nicht mehr entscheiden können. All das hat die Palliativversorgung zum Ziel, sie will so viel Lebensqualität wie möglich erhalten. "Eine frühzeitige Begleitung ist die beste Prävention", sagte der Professor.
Daher spreche er sehr offen mit Menschen über den Tod und stelle dabei immer wieder fest, dass ein Wunsch zu Sterben oft eigentlich vielmehr der Wunsch nach verbesserten Lebensbedingungen ist. Oft lasse sich also an den Umständen etwas ändern, wodurch der Todeswunsch überwunden werde. "Das hat damit zu tun, dass sich das Sterben von zuhause in die Krankenhäuser verlagert hat.", sagte er.

Das Leben in den eigenen vier Wänden sei vielen enorm wichtig, denn oft gehe dem medizinischen ein sozialer Tod voraus. Wertschätzung, persönliche Bindungen, Religion und andere Aspekte seien es, an denen gearbeitet werden könne, eine Herausforderung für das gesamte Umfeld. Die Palliativmedizin sei ein Baustein dazu.
"Die Bereitstellung von Medikamenten zur Beendung des Lebens ist aus meiner Sicht keine therapeutuische Option", so Nauck. Es sei eine Entsorgung, aber keine Lösung. Wobei er einräumte, dass es immer auch Einzelfälle geben könne, in denen eine solche Entschiedung moralisch zu rechtfertigen sei, auch wenn er noch nie ein Leben wegen unerträglichen Leidens beenden musste.
Zum Schluss warnte er davor, dass ein Gesetz zu ärztlicher Sterbehilfe auch eine gewisse Normalität mit sich bringen könnte. Rechne man die Zahlen aus den Niederlanden hoch, so könne bei ähnlicher Gesetzgebung die Zahl der Suizide hier deutlich ansteigen. Es sei aus seiner Sicht aber immer besser, die Symptome von Leid und Schmerzen zu behandeln.
In der anschließenden Diskussion kamen noch weitere Aspekte auf, unter anderem die Frage nach Demenz bei alten Menschen, die dazu führen kann, dass diese nicht mehr leben wollen. Hier sei eine Patientenverfügung absolut wichtig, um das Lebensende frühzeitig zu gestalten, und auch hier gehe es vielmehr um ein Zulassen des Sterbens als um Assistenz beim Suizid, betonte Prof. Nauck noch einmal.
Fortsetzung folgt...
Fremde werden zu Weggefährten
Sieben Männer im Wald - Teil 2
Während wir in der Kirche in Eisdorf und später in Willensen kurz rasten und uns zwischendurch wortwörtlich über Gott und die Welt unterhalten, schwingt diese schwere Stimmung des Karfreitags aber auch immer wieder mit. Wir wissen heute, dass die Auferstehung zu Ostern alles umkehrt. Wusste Jesus es damals auch? Seine Anhänger jedenfalls nicht, sie hatten in dieser Nacht keine Hoffnung.
Zwischendurch denke ich auch immer wieder über meinen eigenen Glauben nach. Durch meine Eltern, insbesondere durch meinen Vater wurde ich früh damit konfrontiert, aber ehrlich gesagt stellte er
mich später auch auf eine harte Probe, weil seine Auffassung des Christentums eine sehr konservative, ja fundamentalistische war, während ich Gott schon immer vielmehr als Freiheit begriff. Für
mich war es eine Art ethischer Kompass, eine Hilfe in moralischen Fragen, ebenso eine Sicherheit, dass ich nie die Hoffnung verlieren muss.

Zu kompliziert, um es jetzt hier detailliert zu erläutern, auf jeden Fall aber hat mich mein Glaube immer begleitet und mir geholfen. So sehr, dass ich heute für die Kirche schreibe und diese Facette meines Berufs auf keinen Fall mehr missen will. Unter anderem auch, weil Kirche eben sehr modern sein kann, weil es viele tolle Ideen gibt und ich immer wieder Abenteuer wie dieses gerade erleben darf.
Wenn meine Gedanken nicht um mich selbst kreisen, nehme ich die nächtliche Natur wahr, da das Mondlicht eben nur die Wege vor uns und viele Umrisse erhellt konzentriere ich mich aufs Hören der
Geräusche der Nacht, aufs Riechen der klaren Luft und auf das Gras, die Erde oder auch das Gestein unter meinen Schuhen. Außerdem tausche ich mich mit den anderen aus, erfahre etwas von ihnen,
gebe etwas von mir preis und stelle fest, wie diese Fremden immerhalb der letzten Stunden zu Vertrauten, eben zu Weggefährten geworden sind.

„Bleibet hier und wachet mit mir; wachet und betet“ singen wir auch an der nächsten Station wieder und auch noch einmal an unserem Ziel, der St. Martin-Kirche in Nienstedt. Dort gibt es dann zum Abschluss noch ein gemeinsames Frühstück, während es draußen allmählich hell wird und die Sonne aufgeht. Wir alle stellen fest, wie intensiv diese Pilgertour doch war. Manchem hat sie den Glauben wieder näher gebracht, andere sind froh über eine besondere Erfahrung, wir alle sind einmal ganz anders in die Ostertage gestartet als üblich. Müder vielleicht und mit schweren Beinen, aber auch nachdenklicher und erfüllter.
Pilgern in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag
Sieben Männer im Wald - Teil 1
Das silberne Licht des vollen Mondes scheint durch die noch kahlen Bäume und erhellt den Weg vor uns. Es geht ein Stück weit bergauf, unsere Schritte sind dank der Dunkelheit besonders deutlich zu hören. Das gilt auch für einen Vogel, den die sieben Männer im Wald da unten wohl erschreckt haben und der plötzlich auf und davonfliegt.
Sieben Männer, darunter Pastor Uwe Rumberg, der zu dieser ungewöhnlichen Pilgertour eingeladen hat. In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag hier bei uns im Vorharz, genauer gesagt von
Badenhausen über Eisdorf, Willensen bis nach Nienstedt. Insgesamt etwa 15 Kilometer. Eine Tour explizit für Männer, denn spezielle Angebote für Frauen gibt es in der Kirche sehr viele, so der
Pastor. Mit dabei sind Stephan, Bernhard, die drei Brüder Wolfgang, Friedhelm und Jürgen und eben ich. Sieben Fremde, die sich gemeinsam zu Fuß auf den Weg machen und dabei die letzten Wege Jesu
vor der Kreuzigung nachvollziehen wollen.
Getroffen haben wir uns zunächst in Nienstedt an der Kirche, von dort aus ging es mit dem Auto nach Badenhausen, eine Fahrt von knapp über fünf Minuten, bei der ich die Landschaft eigentlich noch
nie bewusst wahrgenommen habe. Pfarrer Thomas Waubke (von der Landeskirche Braunschweig oder bei uns hier in der Hannoverschen Landeskirche auch liebevoll „Feindesland“ genannt) hat diesen
Startpunkt zur Verfügung gestellt und uns sogar Brot und etwas zu Trinken hingestellt. Von der Kirche aus ging es dann erst einmal Richtung Burgruine Hindenburg und der Söse, dem kleinen Bach,
dessen Plätschern uns noch häufiger in dieser Nacht begleiten wird. Dort in einem Pavillon, der wohl sonst eher als Grillplatz genutzt wird, feierten wir gemeinsam das Abendmahl.
Ausschließlich bei Kerzenlicht, kurz vor Mitternacht, umgeben von Bäumen und Dunkelheit. Uwe Rumberg erinnerte an das eigentliche Abendmahl, das letzte Abendmahl Jesu mit den zwölf Aposteln zur
Zeit des Passafestes in Jerusalem. Dazu sangen wir das Taizé-Lied mit dem sich wiederholenden Text „Bleibet hier und wachet mit mir; wachet und betet“. Dieses Lied wird uns noch die gesamte Nacht
hindurch begleiten.

Das Passafest wurde nach dem ersten Vollmond im Frühling gefeiert, weshalb sich auch Ostern nach diesem richtet. Der Mond wie gesagt steht hoch über uns am Himmel und sorgt dafür, dass wir überhaupt sicher einen Schritt vor den anderen setzen können. Die Brüder Jürgen, Friedhelm und Wolfgang haben die Ankündigung im Gemeindebrief Wollershausen, einer Gemeinde, die auch noch zu unserem Kirchenkreis gehört, gelesen und beschlossen, sich gemeinsam der Herausforderung zu stellen. So ist einer von ihnen extra aus Bad Gandersheim, der andere sogar aus dem westfälischen Minden angereist.
Die meiste Zeit des Weges lassen die drei sich ein wenig zurückfallen, haben einander viel zu erzählen. Immer wieder bekomme ich mit, wie sie sich gegenseitig aufziehen, sticheln und gemeinsam
darüber lachen. Es muss echte Liebe unter Brüdern sein, die ein Leben lang den Charakter aus Kindertagen bewahrt. Irgendwie berührt mich das.
Stephan hingegen erzählt uns vom Oxfam-Trailwalker, einem großen Spendenlauf über 100 Kilometer, der damals um Osterode stattfand und wo es ebenfalls durch die Nacht ging. „Ich hab schon
viele Wanderungen gemacht, aber diese bei Dunkelheit ist mir besonders in Erinnerung geblieben“, sagt er.

Unser nächstes Ziel ist der Gipfel des Pagenberges, anschließend geht es zum Königstein, wo einst das Königreich Hannover und das Herzogtum Braunschweig aneinandergrenzten. Auf Ebene der Landeskirchen gibt es diese Grenze heute noch, wenn sie auch nicht mehr konfliktbelastet ist.
In den kurzen Ansprachen unseres Pastors geht es aber um die Konflikte des Verräters Judas und die Petrus‘, der Jesus noch in der Nacht des Verrats aus Angst vor Konsequenzen verleugnete. Durch
die Stille der Nacht und die Monotonie der Schritte hallen diese Denkimpulse noch lange nach, die biblische Geschichte fühlt sich wie die Geräusche um uns und jede Veränderung des Bodens unter
unseren Füßen viel intensiver an als während einer Predigt in der Kirche.
Es muss ein schwerer Gang für Jesus gewesen sein, verspottet für all das, was er uns für das Leben in dieser Welt mitgeben wollte, gekreuzigt. Immerhin rief er „Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen?“ (Matthäus 27,46). War er verlassen? Sollte uns musste alles so sein? Welche Bedeutung hat dieser Tod am Kreuz heute für uns?
Fortsetzung folgt...
Kampf zwischen Macht und Moral
Haftbefehl gegen Präsidenten
Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Der russische Präsident soll sich für die Kriegsverbrechen in der Ukraine verantworten, insbesondere die Verschleppung von Kindern wird ihm vorgeworfen. Für viele Experten ist es ein starkes politisches Signal, einige poltern auf Twitter, dass dann doch auch US-Präsidenten angeklagt werden müssten, für die meisten von uns ist es vor allem ein Schauspiel auf der Bühne der Mächtigen, das sehr weit weg erscheint.
Spannend finde ich, dass ich mich schon einmal mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, wenn auch mit anderen Vorzeichen. Der Autor Marc Elsberg hat all dies nämlich in seinem Thriller "Der Fall des Präsidenten" mehr oder weniger exemplarisch durchgespielt. Daher hier sozusagen aus aktuellem Anlass meine Rezension zu diesem Roman, die ich vor zwei Jahren schrieb als Marc Elsberg (zusammen mit Dietmar Wunder als Sprecher) bei uns beim Mordsharz-Festival zu Gast war:
Am Flughafen in Athen wird der ehemalige US-Präsident verhaftet. Im Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs. Kriegsverbrechen werden ihm vorgeworfen. Völlig unerwartet und schockierend für alle Anwesenden, ein internationaler Skandal, wenn die Welt es mitbekommt. Daher werden sofort alle diplomatischen Strippen gezogen, um den Staatsmann so schnell wie möglich und vor allem mit so wenig Aufsehen wie möglich aus seiner misslichen Lage zu holen, notfalls eben mit Drohungen, die das politische und wirtschaftliche Miteinander der USA und Europas auf die Probe stellen.

Doch in der heutigen Zeit lässt sich eine solch nie dagewesene Ungeheuerlichkeit natürlich nicht vertuschen, ein Video taucht im Internet auf und verbreitet sich rasend schnell. Jetzt heißt es, im Hintergrund klug zu agieren, um eine Eskalation, vor allem aber einen Prozess gegen den Präsidenten und damit gefühlt gegen den Hüter der freien Welt zu verhindern.
Allein diese Ausgangslage in Marc Elsbergs Thriller „Der Fall des Präsidenten“ ist ebenso gewagt wie absurd. Gewagt, weil in der Realität so schlicht unvorstellbar, absurd, weil natürlich die Frage gestellt werden muss, warum gerade die USA den Internationalen Gerichtshof in Den Haag nicht anerkennen. Dabei ist der Hintergrund wie so oft bei Marc Elsberg ebenso real wie brandaktuell, die Trump-Regierung hatte die Chefanklägerin mit Sanktionen belegt, allein schon, weil sie mögliche US-Kriegsverbrechen in Afghanistan untersuchte.
Diese Diskrepanz zwischen dem Anspruch der USA als Hüter der freien Welt und dem kalten Hinwegsetzen über internationale Statuten treibt Elsberg auf die Spitze. Seine Anklägerin nennt er Dana Marin, verpasst ihr eine persönliche Motivation durch Kindheitserfahrungen im Kosovokrieg und spielt die Verhaftung des in diesem Fall fiktiven Präsidenten gut recherchiert durch.
Vor Gericht wird ganz im Stil des klassischen Gerichtsthrillers verhandelt, ob es überhaupt zur anklage kommen darf, hinter den Kulissen werden die diplomatischen und auch militärischen Möglichkeiten ausgelotet. Zudem tobt in den Medien und damit in der Öffentlichkeit ein Krieg um die Deutungshoheit dieser Angelegenheit und natürlich werden Dana Marin und alle in ihrem Umfeld diffamiert, eingeschüchtert und bedroht.

Wie immer in seinen Büchern entwirft Marc Elsberg ein Szenario, das im Grunde schon morgen eintreten könnte und spielt es konsequent und sehr detailliert durch. Alles, was er schreibt, wirkt akribisch wirklichkeitsnah konstruiert, was es umso erschreckender macht und abseits der eigentlichen Handlung viele Fragen zum fragilen Gefüge der internationalen Politik und eben insbesondere zur Rolle der USA in der Welt aufwirft. Es geht letztlich um nicht weniger als den Kampf zwischen Macht und Moral, wohl eines der wichtigsten Themen unserer Zeit oder der Menschheit überhaupt.
Besonders erfreulich ist aber, dass Marc Elsberg mit Dana Marin eine lebensecht wirkende Hauptfigur geschaffen hat, die nicht nur ihre Funktion als Mittlerin für den Leser erfüllt. Besonders eine Szene, in der Dana sich mit dem Taxi zum Gericht fahren lässt und dabei mit dem Fahrer ins Gespräch kommt, zeigt, dass ihm auch die kleinen, zwischenmenschlichen Szenen gelingen. Der Taxifahrer macht deutlich, dass er nicht auf ihrer Seite ist, weil er sich vor den Konsequenzen eines solchen Prozesses fürchtet. Natürlich weiß er, dass die Kriegsverbrechen in Afghanistan zu verurteilen sind, ist aber fest überzeugt, dass man immer nur die Kleinen hängt, während man die Großen laufen lässt, und dass ein Prozess gegen die USA die nächste Wirtschaftskrise nach sich zieht, von der dann auch er und seine Familie betroffen sein wird.
In Szenen wie dieser wird immer wieder deutlich, wie brisant das Thema ist, weil es um äußerst plausible Szenarien geht, die genau wie in Elsbergs anderen Büchern „Blackout“, „Zero“, „Helix“ und „Gier“ letztlich jeden Einzelnen betreffen können. Er legt mit seinen Thrillern den Finger in Wunden, die viele vielleicht nicht als solche erkennen und regt damit immer wieder wichtige Diskussionen an.
Auf jeden Fall bin ich gespannt, ob diese Fiktion im Falle Putin zum Teil wahr werden wird. Und ganz aktuell ist übrigens Marc Elsbergs neuester Thriller "°C - Celsius" erschienen, in dem es um die Erderwärmung geht, auf den ich auch schon äußerst neugierig bin.
We are all from the same blood
Brauchen wir mehr Eurovision Song Contest?
Der Eurovision Song Contest oder damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hat mich schon als Kind fasziniert. Sehr gut kann ich mich noch an einen Abend erinnern als ich bei Bibi, einer guten Freundin der Familie übernachtet habe – damals liebte ich es an den Wochenenden bei Oma und Opa, meiner Großtante oder anderen Erwachsenen zu übernachten, weil es einfach ein Abenteuer war – und wir abends keinen Zeichentrickfilm, sondern den Grand Prix geguckt haben.
Bibi war eine alleinstehende Lehrerin, vor allem Künstlerin, ein wenig exzentrisch und für mich eben anders als viele andere damals. Vor allem aber liebte ich es, dass sie mich nicht wie ein
kleines Kind behandelte, sondern ich mich bei ihr ernstgenommen und dementsprechend erwachsen fühlte. So auch an diesem Abend als ich die bis in die Nacht dauernde Show ganz selbstverständlich
und ohne Diskussionen bis zum Ende mit ihr ansehen durfte.
Außerdem begeisterte mich das Konzept, dieser internationale Wettstreit, dieser Blick über den spießig deutschen Tellerrand hinaus, kurzum ich fühlte mich erwachsen und weltgewandt wie selten
zuvor. Ehrlich gesagt weiß ich heute nicht mehr, welcher deutsche Song damals teilnahm oder wer den Contest gewann, aber das war ja auch nebensächlich, ging es doch um Völkerverständigung, um
Einblicke in fremde Kulturen und um die große weite Welt des internationalen Showgeschäfts.

Diesen Status hat der ESC für mich im Grunde immer behalten, wenn vielleicht auch mit kleinen Abstrichen in der B-Note. Auf jeden Fall aber habe ich die Show viele Jahre lang gesehen, ein besonderes Highlight war dabei das Public Viewing in einer Kirche. Das Gotteshaus feierte 300-jähriges Bestehen, es sollte etwas Besonderes werden und im Sinne des grenzenlosen Miteinanders gab es eine Predigt mit dem Tenor, dass wir ja alle Gottes Kinder sind und Grenzen etwas absolut Weltliches und eben Menschengemachtes, bevor dann gemeinsam auf einer großen Leinwand der ESC geguckt wurde.
Mich persönlich freute, dass damals Bonnie Tyler für das Vereinigte Königreich antrat, die meisten anderen drückten Cascada für Deutschland die Daumen, gewonnen hat am Ende Emmelie de Forest mit
„Only Teardrops“, ehrlich gesagt bis heute einer der besseren Siegertitel. Auf jeden Fall war auch das für mich wieder ein unvergesslicher Abend und letztlich auch eine Bestärkung darin, dass ich
ein zusammenrückendes Europa als tolle Idee ansehe, während mir Nationalstolz ehrlich gesagt ziemlich fremd ist.
Nun ist der ESC sicher vielmehr Medienspektakel als gesellschaftsprägend, trotzdem mag ich die Idee dahinter nach wie vor und bin auch nach wie vor überzeugt, dass solche Events über Grenzen
hinweg wichtig sind. Es mag sein, dass sie bei einigen genau wie beispielsweise Fußball auf internationaler Ebene den Nationalismus nur noch mehr fördern, bei mir bewirkte es immer klar das
Gegenteil. Ich beschäftigte mich dadurch mehr mit mir fremdem Musikgeschmack, versuchte zu verstehen und war ehrlich gesagt äußerst selten Fan der deutschen Beiträge und Teilnehmer.

Das änderte sich in diesem Jahr. Lord of the Lost höre und mag ich seit zehn Jahren, genaugenommen seit einem Festival, bei dem ich die Band damals live erlebte und ziemlich begeistert war. Noch spannender wurde es für mich als Nik dort als Drummer einsteig, Nik, den ich kenne, seit er quasi Nachbar meiner Ex-Freundin war, und der auch heute wieder kaum drei Straßen von mir entfernt wohnt.
Ja, bei diesem ESC bin ich parteiisch, allerdings mag ich auch „Blood & Glitter“ sehr, den Song und auch das gesamte Album. So war es selbstverständlich, dass wir am vergangenen Freitag zum
Vorentscheid unsere eigene kleine ESC-Party gefeiert und Lord of the Lost die Daumen gedrückt haben. Ganz abgesehen vom Ergebnis war es fast wieder so schön und so spannend wie damals bei Bibi.
Noch viel spannender fand ich allerdings am nächsten Tag etliche Kommentare auf Social Media. Manche fanden die Musik schlicht zu laut, okay, das ist einfach der persönliche Geschmack. Andere
wünschten sich Nicole zurück, also das typische Früher-war-alles-besser-Gejammere, was ich immer schon ziemlich unerträglich finde. Wieder andere regten sich über die Kostüme auf, die Band und
der Song waren ihnen zu wenig deutsch, zu divers, zu linksgrünversifft, was auch immer.

Da frage ich mich dann immer, ob der Song wirklich der Auslöser ist oder ob solchen Leuten nicht im Grunde alles recht ist, um gegen die da oben etc. zu hetzen. Normale Bürger würden sich nicht von den „pinken Herren“ vertreten lassen wollen, twitterte Frauke Petry. „Keine Sorge, Frauke, euch ‚normale Bürger‘ vertreten wir auch nicht. Haben wir nie, werden wir nie“, antworteten Lord of the Lost. Auch ich konnte es mir nicht verkneifen, das zu kommentieren und schrieb: „Naja, Frau Petry, Lord of the Lost wurden von einer Mehrheit gewählt. Das wurden Sie schon länger nicht mehr, oder?“
Eigentlich mag ich mich an sowas ja gar nicht beteiligen, denn es bringt ja doch nichts. Allerdings finde ich es immer wieder unerträglich, wenn alles, was den eigenen Dunstkreis übersteigt, erst
einmal abgelehnt oder gar verteufelt wird. Vor allem, wenn es nur um neue Musik geht oder um vegane Schnitzel oder von mir aus auch um Gendersternchen.
Haben wir keine wirklichen Probleme? Ja, die Frage ist rhetorisch. Aber ich frage mich immer mehr, warum sich Menschen über Kleinigkeiten derart ereifern und letztlich Lager bilden, die zu tiefen
Rissen in unserer Gesellschaft führen. Da frage ich mich dann, ob wir nicht noch viel mehr Eurovision Song Contes brauchen, um zumindest in Sachen Musik toleranter zu werden. Und noch viel mehr
„Blood & Glitter“, denn da heißt es im Text: „We are all from the same blood.“
Ist Harry Potter transphob?
Das schwere Vermächtnis der Frau Rowling
Das Spiel „Hogwarts Legacy“ erscheint am kommenden Freitag und sorgt schon seit Wochen für Schlagzeilen. Weil es im Harry Potter-Universum spielt und weil dessen Schöpferin J. K. Rowling sich seit längerer Zeit immer wieder kritisch gegenüber Transpersonen äußert. Für viele steht nun die Frage im Raum, ob das Spiel aufgrund der transphoben Haltung der Autorin boykottiert werden sollte.
Das Thema ist so viel komplexer als diese eine Fragestellung. Es fängt damit an, dass Rowling nicht gegen Transmenschen an sich wettert, sondern vor allem behauptet, das biologische Geschlecht
sei nun einmal ein Fakt. Das brachte ihr in der öffentlichen Diskussion die Bezeichnung „TERF“ ein, Trans-Exclusionary Radical Feminism, also eine radikale Feministin, die Transfrauen nicht als
Frauen ansieht. Mit verschiedensten Äußerungen auf Social Media befeuerte die Autorin die Diskussion immer wieder, was auch immer wieder aufgegriffen wurde.
Hierzu bleibt festzustellen, dass das Transgender-Thema in der öffentlichen Diskussion noch relativ jung und damit für viele Menschen ein völlig unbekanntes Feld ist. Durch das Gendern und
insbesondere das Sternchen, das explizit non-binäre Menschen einbeziehen soll, ist es auch bei uns immer wieder präsent, wenn es um Sprache und Diskriminierung gilt.

Da es eben eine noch relativ junge Diskussion ist, möchte ich an dieser Stelle klarstellen, dass auch ich längst nicht genug darüber weiß, um es kompetent aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und mich daher lediglich als Sprach- und Literaturwissenschaftler herantaste. Das aber möchte ich auf jeden Fall tun, weil es mir wichtig erscheint und offenbar ja auch für sehr viele Menschen ein Reizthema ist.
Letzteres wurde in der vergangenen Woche besonders deutlich, als der Streamer Gronkh auf Twitch ankündigte, er wolle „Hogwarts Legacy“ nach Release spielen. Allein das brachte ihm harsche Kritik
ein. Vermutlich werde er aufgrund der Brisanz einen Spendenstream daraus machen und Geld für eine Organisation für die Rechte von Transmenschen sammeln, führte er aus. Da er dennoch weiter
angefeindet wurde, stellte er klar, dass es ihm keinesfalls darum gehe, J. K. Rowling zu unterstützen oder ihrer Meinung eine Plattform zu bieten (zumal sie mit dem Spiel an sich nichts zu tun
habe), diese Frau sei ihm egal.
Genau dieser letzte Satz, dass J. K. Rowling in seinem Leben keine Rolle spiele, wurde wiederum auf Social Media aufgegriffen, wo ihm verschiedene Menschen nun eine transphobe Haltung
unterstellten. Wem Transpersonen egal sind, fördere damit die Diskriminierung, so die Argumentation. Twitter brannte förmlich, aber gut, Twitter brennt ja eigentlich immer.
Interessant an dieser Episode ist, welche großen Kreise eine kleine Äußerung plötzlich ziehen kann, wie viel zwischen den Zeilen doch immer wieder interpretiert wird, wovon Menschen sich
angegriffen bzw. getriggert fühlen und dass es letztlich vor allem jene waren, die ohnehin gegen Transmenschen hetzen, die sich nun bestätigt fühlten. Warum? Weil die ja schlicht alles nutzen, um
sich als Opfer darzustellen... oder so ähnlich.

Aus Sicht des Sprachwissenschaftlers möchte ich nun hierzu anmerken, dass unsere Sprache sich immer schon parallel zur Gesellschaft entwickelt, also in einem stetigen Wandel ist. Immer mal wieder werden solche sprachlichen Entwicklungen in ein Regelwerk gegossen, aber vor allem bildet sie uns Menschen ab, unsere Gesellschaft und damit auch alles, was für diese Gesellschaft ein Thema ist.
Wenn nun gesellschaftlich darüber diskutiert wird, ob Frauen benachteilig werden und ob das auf homosexuelle Menschen noch mehr und auf Transpersonen am allermeisten zutrifft (ja, die Darstellung
ist verkürzt), dann schlägt sich das auch immer in der Sprache nieder. Es ist somit kein Wunder, dass in den vergangenen Jahren über die Sichtbarkeit weiblicher Berufsbezeichnungen oder auch über
das Gendersternchen diskutiert wird. Welche Formen sich letztlich durchsetzen, wird allein die Zukunft zeigen.
Dass diese sprachlichen Unklarheiten diskutiert werden, ist gut und richtig. Nur so kann sich Sprache entwickeln, nur so kann sich auch eine Gesellschaft entwickelt, weil die letztlich auch durch
ihre Sprache geprägt wird. Warum solche Diskussionen aber oft derart verbittert geführt werden, erschließt sich mir nicht. Warum sich Menschen durch ein Sternchen persönlich angegriffen fühlen,
kann ich schlicht nicht nachvollziehen.

Aus literaturwissenschaftlicher Sicht geht es bei „Hogwarts Legacy“ um die Frage nach der Trennung von Werk und Autor. Lässt sich beides unabhängig voneinander betrachten? Ganz klar ja. Solange das Werk nicht eindeutig die Ideologie der Autor*in bedient, kann es erst einmal für sich stehen.
Auf der anderen Seite kann eine gewisse Haltung selbstverständlich auch so schwer wiegen, dass es subjektiv nicht mehr möglich ist, ein Werk zu mögen, wenn die Autorin oder der Autor eine Haltung
vertritt, die ich so gar nicht teile. Allerdings glaube ich, dass wir mit solchen strikt ablehnenden Urteilen vorsichtig sein müssen, erst recht in einem Fall, in dem die Autorin (Rowling) mit
dem Werk (Hogwarts Legacy) direkt kaum noch etwas zu tun hat.
Wenn ich nämlich anfange, alles zu boykottieren, an dem jemand beteiligt ist, dessen Meinung zu irgendetwas nicht gefällt, dann bleibt am Ende nicht viel übrig. Müsste ich dann nicht auch Disney
boykottieren, weil Walt so gar kein Problem mit den Nazis hatte?
Genau diese letzte Frage stellte ich kürzlich auch auf einer Plattform im Netz und bekam zu meiner Verwunderung folgende Antwort: „Was du findest finden andere ganz anders und wer gibt dir das
Recht zu sagen daß es anders empfunden werden muss. Dein empfinden ist deins und das andere das andere. Wenn mir bei Transen schlecht wird und dich das aufgeilt kannst du mir das nicht aufzwingen
weil wer bist du? :) Kapiert?!“ Nee, hab ich nicht kapiert.
Boris auf dem Basar
Boris Pistorius wird Bundesverteidigungsminister - Teil 3
Wenn ich das richtig sehe, schulde ich euch noch den letzten Teil meiner Begegnung mit Boris Pistorius in der Erstaufnahmestelle. Die Geschichte muss ja noch ihr würdiges Finale finden oder eben die Erklärung, warum mir dieser Tag so in Erinnerung geblieben ist. Hier kommt es also:
In der Konferenz sprach Boris Pistorius dann über die 600 Plätze, die es in der Unterkunft eigentlich gab und über die 850 Menschen, die zu jenem Zeitpunkt im Spätsommer 2014 dort lebten. Doch er verwehrte sich gegen die Aussage, das Boot sei voll und plädierte stattdessen für mehr Geld für die Aufnahme von Flüchtlingen und eine Erweiterung der Aufnahmekapazitäten, um die auf uns zukommenden Engpässe wenigstens einigermaßen in den Griff zu bekommen. Vor allem sollten die Kommunen vom Bund mehr unterstützt werden, da sie diejenigen seien, bei denen sich steigende Flüchtlingszahlen am deutlichsten bemerkbar machen. Dazu müssten dann eben auch ein paar Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht werden.
Damals war Pistorius einer der ersten, zumindest aber einer der entschlossensten Politiker, die so argumentierten. Auf große Resonanz trafen seine Forderungen bekanntermaßen nicht. Heute frage ich mich immer noch, warum die Politik nicht schon viel früher reagiert hat, nicht schon viel früher weitere Flüchtlingsunterkünfte geschaffen hat und vor allem nicht viel mehr in Bewegung setzte, um den Bürokratiestau bei den Asylanträgen und bei den elementaren Voraussetzungen für die Integration in unserem Land abzubauen. Hätte das nicht von Anfang an viel mehr Bereitschaft in der Bevölkerung geschaffen, die Entscheidungen mitzutragen?

Nach der Pressekonferenz machte ich mich jedenfalls schnell auf den Weg zu unserem Basar, wo mittlerweile großer Andrang herrschte. Ich möchte fast sagen, die Kleidung wurde den Damen aus der Hand gerissen, doch das stimmt einfach nicht. Die meisten Menschen aus aller Herren Länder hielten geduldig die Hand auf, lächelten und bedankten sich wortreich in Sprachen, die wir nicht verstanden. Viele von ihnen nahmen die Klamotten genau unter die Lupe, untersuchten, ob sie passten und gaben sie anderen, wenn das nicht der Fall war. Mich rührten vor allem die großen Kinderaugen, die leuchteten, wenn sie Kuscheltiere oder anderes Spielzeug in die Hand gedrückt bekamen.
Minister Pistorius gab währenddessen den Fernsehleuten ein paar schnelle Interviews, dann kam er tatsächlich zu unserem Stand herüber. Und er nahm sich sogar Zeit, einige Worte mit den Damen zu wechseln. Frau B. erzählte von ihrer Erfahrung mit den Asylanträgen und fragte, warum der Staat den Flüchtlingen dafür nicht einen Begleiter zur Seite stellen könne. Leider gebe es dafür kein Geld, antwortete Pistorius sinngemäß, die Flüchtlinge seien grundsätzlich auf sich allein angewiesen. „Deshalb ist es ja so wichtig, dass es ehrenamtliche Helfer wie Sie gibt.“

Vielleicht war es dieser Moment oder vielmehr diese Erkenntnis, die mir zeigte, dass das, was diese Gemeinde und andere taten, keinesfalls ein Selbstzweck war. Vielmehr war es der wichtigste Baustein, um ein programmatisches „Wir schaffen das“ Wirklichkeit werden zu lassen. Selbst wenn der Staat Flüchtlinge aufnimmt und sie damit vor Krieg, Hunger und Verfolgung bewahrt, ist das immer nur der erste Schritt. Der zweite besteht darin, ihnen einen wirklichen Neuanfang zu ermöglichen. Und der kann nur gelingen, wenn zu den offensichtlichen Voraussetzungen auch die weniger sichtbaren hinzukommen.
Licht ins Dunkel des Vergessens bringen
Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust
Der 27. Januar sei nicht nur ein in die Vergangenheit gerichteter Gedenktag für die Opfer des Holocaust, sondern auch für die Gegenwart von Bedeutung, sagte Dr. Elke Gryglewski, Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten. "Seit 2015 haben wir eine Partei im Bundestag, die Erinnerungskultur infrage stellt", begründete sie ihre Aussage, außerdem einen sich immer weiter in der Gesellschaft ausbreitenden Rassismus. Allerdings sei das zu einfach, um zu begründen, warum das Erinnern in unserer Gesellschaft wichtig ist.
Dr. Gryglewski war im Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt zu Gast, wo sie am Vormittag gemeinsam mit ihrer Kollegin Marie Kuehnel, FSJ an der Gedenkstätte Bergen-Belsen, einen Workshop zur Gedenkkultur in der Bundesrepublik und zum Erinnern in der Region anbot und am Abend im Forum des Schulzentrums einen Vortrag hielt. Beides ist Teil einer großen ökumenischen Gedenkwoche, wie Pastor Johann-Hinrich Witzel erläuterte.
Mit einem Budget der Hanns-Lilje-Stiftung stellte er verschiedene Veranstaltungen auf die Beine, um die Bedeutung der Aufarbeitung und des Gedenkens für den Kirchenkreis Harzer Land bzw. das Eichsfeld herauszustellen und um "Licht ins Dunkel des Vergessens zu bringen", wie er sagte. Die Stadt Duderstadt und eben die Schule waren sofort mit dabei.

Jene Menschen, derer gedacht wird, wurden im Nationalsozialismus ermordet", betonte Dr. Gryglewski, die Folgen dieser Verbrechen seien in den Familien der Opfer wie auch der Täter bis heute spürbar. Zwar sei die Jugend von heute damals nicht dabei gewesen, viele haben auch keine Eltern und Großeltern mehr, die von dieser Zeit aus eigenem Erleben berichten können, doch gerade das mache eine Auseinandersetzung damit so wichtig.
Dabei gelte auch zu bedenken, dass viele von der Ideologie des Nationalsozialismus überzeugt waren oder vielen tatenlos hingenommen haben, auch später noch. Viele Täter bekleideten auch in der Zeit nach 1945 wieder hohe Ämter, andere flohen und wurden nie zu Rechenschaft gezogen. "Viele Nazis waren noch sehr einflussreich", so die Referentin.
Doch war eigentlich Täter? Waren es die, die tatsächlich an Gräueltaten beteilig waren oder auch die, die wegschauten und sie somit zuließen? Diese Frage sei nicht so leicht zu beantworten. "Das System hatte viele Schreibtischtäter und Mitwisser", sagte Elke Gryglewski, "ich glaube, dass die Täter*innen viel zu gut davongekommen sind." Die Schäler hätten sie am Vormittag bereits nach dieser Einschätzung gefragt. Die Ideologie lebte jedenfalls fort und viele Opfer wie beispielsweise Sinti und Roma, blieben Opfer.

In der anschließenden Diskussion, die ebenfalls sehr auf die Schüler zugeschnitten war, aber durchaus auch die vielen anderen Besucher einbezog, ging es dann unter anderem um die Frage nach der Aufarbeitung in unseren Nachbarländern. Mit dortigen Gedenkstätten kooperiere man natürlich, erläuterte Dr. Gryglewski, doch sei die Situation in den Niederlanden, in Frankreich, in Polen jeweils eine spezifische und somit auch die Aufarbeitung. Wichtig sei ihr aber, das es geschieht, auch um die Demokratie heute zu stärken.
So kamen in dieser Diskussionsrunde viele persönliche Erfahrungen und auch weitere Fragen auf, die zunm einen deutlich machten, dass längst nicht alles beantwortet ist, und zum anderen, dass Erinnern lebendig ist und die Geschichte tatsächlich bis heute Auswirkungen auf uns hat. Daher gibt es auch weitere Veranstaltungen zum Gedenktag, so beispielsweise ein Konzert des Klezmer-Projekt-Orchesters am Freitag, 27. Januar, ab 20 Uhr im Schulzentrum sowie die Ausstellung "Christliche Märtyrer", die zum Wochenende dann in die St. Servastius-Kirche umziehen wird.
Alle wichtigen Medien... und ich
Boris Pistorius wird Bundesverteidigungsminister - Teil 2
Bevor ich nun allerdings Nebelkerzen werfe und vor mich hinschwurble, möchte ich euch noch eine Anekdote erzählen, an die ich im Zusammenhang mit Boris Pistorius immer denken muss. Diejenigen, die diesen Blog von Anfang an verfolgen, kennen die Geschichte, trotzdem möchte ich sie euch noch einmal erzählen.
Irgendwann im Sommer 2015 besuchte ich erstmals eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete. Ein Pastorenehepaar hatte eine Kleidersammlung ins Leben gerufen. Sie hatten einer Flüchtlingsfamilie bei den Anträgen beim Bundesamt für Migration in Braunschweig geholfen und sich dabei ein Bild von den Unterkünften machen können. „Wir erlebten Menschen, die trotz Dolmetscher mit der deutschen Bürokratie überfordert waren und Kinder, die seit ihrer Flucht nichts besaßen außer den Kleidern, die sie am Leib trugen“, erzählte mir Pastorenehefrau B.
Kurzerhand riefen sie in der Gemeinde zu einer Kleiderspende auf, bei der Kartons für zwei große Transporter zusammenkamen. Die Landesaufnahmebehörde erlaubte einen Basar auf ihrem Gelände, allerdings mussten die Initiatoren alles selbst organisieren. Alles, was ich tun konnte, war zuzusichern, dass ich mitkommen und über das ehrenamtliche Engagement berichten würde. „Könnten Sie dann vielleicht auch einen der Transporter fahren?“, fragte mich Pastor B. Außer ihm waren es nun einmal überwiegend Helferinnen und kaum eine traute sich mit einem größeren Gefährt als dem eigenen Pkw vom Harz aus in die große Stadt zu fahren. Wenn ich ehrlich war, hatte ich seit meiner Zivizeit auch keinen Transporter mehr durch Innenstädte manövriert, doch ich sagte natürlich zu. Wann bekommt man als Journalist schon mal die Gelegenheit zu praktischer Arbeit?

Tatsächlich kamen wir schließlich auch gut auf dem Gelände an und während Pastor B. und seine Damen den Basar vorbereiteten, machte ich mich auf den Weg zur Pressekonferenz des Niedersächsischen Innenministers, der zufällig an diesem Tag auch in der Einrichtung war. Auf dem Weg dorthin kam ich an Kasernengebäuden vorbei, aber auch an auf den Rasenflächen aufgebauten Containern. Dicht an dicht standen sie, dazwischen Wäscheleinen, Kinderwagen und manches mehr, was jetzt im Sonnenschein nach Alltag aussah. Vorstellen, wie man als Familie in so einem Container über mehrere Wochen leben konnte, wollte ich mir jedoch lieber nicht.
Vorm Eingang des Hauptgebäudes hatten sich schon Kollegen vom NDR, ZDF und RTL mit ihren Kameras und andere von der Braunschweiger Zeitung oder der Hannoverschen Allgemeinen positioniert, dass ich auf die Gästeliste gerutscht war, konnte kaum mehr als ein glücklicher Zufall sein. „Und für wen sind Sie hier?“, fragte mich die nette Security-Dame. „Ich schreibe für den Kirchenkreis Harzer Land“, antwortete ich wahrheitsgemäß und werde wohl nie die irritierten Blicke der anderen Journalisten vergessen.

„Philipp?“, fragte ich nur irritiert. Dass er jetzt Pressesprecher im Innenministerium war, wusste ich nicht, vor ein paar Jahren, damals in Osnabrück, war er jedenfalls noch einer der jüngsten meiner Dozenten an der Uni gewesen. Somit gab es für die Kollegen der großen Medien die zweite Überraschung als ich nämlich nicht nur so dreist war, um ein paar exklusive Fotos des Ministers mit unseren ehrenamtlichen Helferinnen zu bitten, sondern auch noch als Antwort bekam: „Na okay, ich sehe mal, was ich für dich machen kann.“
Fortsetzung folgt...
„Wir haben in den letzten dreißig Jahren verlernt, mit Gefahren zu leben“
Boris Pistorius wird Bundesverteidigungsminister - Teil 1
Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister. Das las ich heute als erste Schlagzeile und weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Pistorius war von 2006 bis 2013 Osnabrücker Oberbürgermeister, anschließend dann Innenminister von Niedersachsen. Er machte in der Vergangenheit durch zum Teil markige Worte zum Thema Islamismus, Abschiebung von Gefährdern und zur Asyl- und Flüchtlingspolitik sowie zu Rechtsextremismus und -populismus auf sich aufmerksam.
Fakt ist für mich, dass seine Vorgängerin Christine Lambrecht sich nun wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert hat und wenn sie bei ihrem Abtreten dann auch noch den Medien die Schuld geben will, dem Amt offenbar schlicht nicht gewachsen war. Da Pistorius soweit ich das beurteilen kann innerhalb seiner Partei, der SPD, eine gute Reputation hat, ist sein Schritt auf die politische Bundesebene keine allzu große Überraschung.
Nun lebte ich noch in Osnabrück als Pistorius dort noch Bürgermeister war. Soweit ich das beurteilen kann, hat er keinen schlechten Job gemacht, ganz im Gegenteil. Das gilt ebenso für seine Arbeit als niedersächsischer Innenminister. Er hatte eine klare Linie, deutliche Positionen, hat sich hier insbesondere immer wieder für bessere Bedingungen für die Polizei und die Rettungskräfte stark gemacht.

Als Lokaljournalist habe ich natürlich immer nur einen eingeschränkten Blickwinkel, aber insbesondere als er im vergangenen Jahr bei der hiesigen Feuerwehr zu Gast war, hatte ich den Eindruck, dass sein Ansehen dort ganz gut ist und vor allem diskutierte er sehr offen mit den Leuten und konnte auch zuhören, was bei Politikern ja nun mal eine eher seltene Eigenschaft ist.
„Seit ich im Amt bin, ist vieles nicht leichter geworden“, sagte Pistorius, seitdem gab es immer wieder politische und zivile Herausforderungen wie die Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft, die Flut im Ahrtal oder einen Angriffskrieg auf europäischem Boden. All das betrifft nicht nur die „große Politik“, sondern auch viele Einsatzkräfte und Ehrenamtliche vor Ort. Durch Putins Krieg und nicht zuletzt den Klimawandel werden die Herausforderungen nicht geringer, schloss er und betonte, dass wir auf Katastrophen welcher Art auch immer vorbereitet sein sollten, weshalb er auch die Investitionen in die Bundeswehr für absolut richtig hält. „Wir haben in den letzten dreißig Jahren verlernt, mit Gefahren zu leben“, sagte er, jetzt scheint eine andere Zeit angebrochen zu sein.

Ob er wirklich etwas von Außenpolitik, von der Bundeswehr, vom Job als Verteidigungsminister versteht, weiß ich schlicht nicht. Allerdings brauchen wir in Zeiten eines andauernden und vermutlich noch lange andauernden Krieges in der Ukraine in diesem Amt jemanden, der überlegt ist, und der auch etwas davon versteht oder zumindest einen weiten Blick auf diesen Konflikt und alles, was damit zusammenhängt hat.
Da ich grundsätzlich das Gefühl habe, dass unsere Regierung vor allem mit sich selbst zu tun hat, mit dem Zusammenspiel der Koalitionspartner, mit der geschlechtergerechten Besetzung von Posten, damit, überhaupt eine klare Linie zu finden, hoffe ich einfach, dass Boris Pistorius mit Blick auf die Sache und nicht auf die Personalkonstellation berufen wurde. Immerhin verliere ich als Niedersachse einen guten Innenminister und es wäre schade, wenn ich dafür einen schlechten Verteidigungsminister bekäme.
Fachkräftemangel und Rassismus
Warum Jawed Karim Youtube nicht im Harz gründete
Wisst ihr, was das erste Youtubevideo war? Es hieß „Me at the zoo“ und zeigte einen jungen Mann vor dem Elefantengehege im San Diego Zoo. Cool sei, dass die Elefanten so einen langen Rüssel haben, sagte er, dann war es nach 19 Sekunden auch schon wieder vorbei. Um die Elefanten und ihre Rüssel soll es hier aber nicht gehen, sondern um den Videoersteller, der niemand anders war als Jawed Karim, Mitgründer der heute millionenfach genutzten Website.
Was überraschen mag: Jawed Karim ist Deutscher. Er wurde 1979 in Merseburg geboren, sein Vater Naimul stammt aus Bangladesh und arbeitete hier als Chemiker, seine Mutter Christine kommt ganz aus meiner Nähe, aus Wernigerode, ist heute Assistenz-Professorin in Minnesota. Ihren Mann lernte sie während des Studiums kennen.
Die Familie reiste 1982 aus der DDR aus, weil sie sich dort nicht mehr willkommen fühlte. „Wir passten nicht ins Bild“, sagte Christine Karim vor einigen Jahren der Zeit in einem Interview, „„Die Leute sagen mir jetzt immer, was für ein Glück, dass ihr raus durftet. Ich wäre aber eigentlich gern geblieben, das war ja meine Heimat.“ Doch auch Westdeutschland sollte nicht für immer ihre Heimat bleiben.

Der Grund für das Auswandern in die USA waren zum einen ein Jobangebot für Naimul Karim, zum anderen die ausländerfeindliche Stimmung in Deutschland und ganz konkret die fremdenfeindlichen Übergriffe in Hoyerswerda, Rostock und Mölln. So kam Jawed 1992 in die USA, studierte Informatik und gründete mit mit 26 Jahren gemeinsam mit Chad Hurley und Steve Chen Youtube. Ein Jahr später wurde die Videoplattform an Google verkauft, Jawed erhielt laut Wikipedia für seine Anteile 64 Millionen US-Dollar, mit denen er kurz darauf ein Unternehmen gründete, das Studenten finanziell unterstützt, ihr eigenes Start-Up aufzubauen.
All das hätte mit einigen veränderten Vorzeichen also auch in Deutschland stattfinden können und wer weiß, vielleicht würde Jawed Karim dann heute Frank Thelen den Rang als bekanntester Investor Deutschlands und Internet-Wirtschaftsexperte streitig machen. Wäre ja nicht das Schlechteste. Doch die Geschichte lief eben anders. „Das war 1992 eine schlimme Situation in Deutschland“, sagte Christine Karim im zitierten Interview. Ganz anders in Minnesota: „Die Leute interessierten sich für uns. Wir waren jetzt Einwanderer und wollten ein Teil dieser Gesellschaft werden.“
Besonders dieser letzte Satz sagt doch unglaublich viel aus. Zum einen wollte die Familie Teil der Gesellschaft werden, in die sie ausgewandert waren. Das ist genau jener Punkt, den viele Konservative und Rechte den Zuwanderern und Geflüchteten hierzulande immer wieder absprechen. Zum anderen sagt Christine Karim aber auch, dass die Leute dort sich für sie interessierten. Wohlgemerkt damals, im Amerika vor Bush Junior und Trump.

Der Journalist, Kolumnist und Diplom-Theologe Stephan Anpalagan griff die Geschichte Jawed Karims jetzt auf Twitter im Zusammenhang mit den Diskussionen um die Silvesternacht auf. „Dass Deutschland für Spitzenforscher, Fachkräfte und Experten so unattraktiv ist, hat 0,0% mit „Bürokratie“ oder mit „hohen Steuern“ zu tun, wie Friedrich Merz suggeriert. Es hat zum einen damit zu tun, dass englischsprachige Expats in Deutschland keine Perspektive haben“, schreibt er, „Zum anderen lesen Fachkräfte aus dem Ausland all diese Diskussionen um „Migrationshintergrund“, „gescheiterte Integration“, „Sozialtourismus“ und ähnlichem mit.“
All das schrecke viele ausländische Fachkräfte ab, jede Querdenker-Demo, jeder Neonazi-Anschlag, aber auch die politischen und medialen Diskussionen, in denen sich auf der einen Seite „fest verankerter Rassismus in der Mitte der Gesellschaft“ offenbare. Deutschland könne, so mutmaßt Anapalagan, seit Jahrzehnten die technologische Vorherrschaft in weiten Teilen der Industrie innehaben und eine Sogwirkung für Software-Entwickler haben, wenn denn der Rassismus nicht wäre. Klingt für mich plausibel.
Bei aller Diskussion um integrationsunwillige Jugendliche in der zweiten und dritten Generation ist dies eben die andere Seite. Es kann selbstverständlich darüber diskutiert werden, ob unsere Migrationspolitik richtig ist, ein einseitiges Migrantenproblem, wie es populistisch häufig und gerade jetzt wieder dargestellt wird, haben wir allerdings nicht, wohl aber ein Fachkräfteproblem und - da müssen wir eben dfen sprichwörtlichen Elefanten im Raum nun doch noch ansprechen - auch ein Rassismusproblem.
Erstes Weihnachtsgeschenk seit 20 Jahren
Spendenaktion des Youtubers und Mountainbikers NoHandMTB für Obdachlose
Zum Glück erlebe ich in meinem Job als Journalist immer wieder Momente, die mir zeigen, dass nicht alles schlecht ist, dass auch Nachrichten nicht immer negativ sein müssen. Genau diese positiven Themen suche ich mir gezielt raus und hoffe, dass ich mit solcher Berichterstattung auch einige Leser positiv beeinflussen kann. Konstruktiven Journalismus nennt man das im Fachjargon.
Vor einigen Wochen wandte sich der Mountainbiker und Youtuber NoHandMTB an mich, weil er gerne einen Text haben wollte, mit dem er an klassische Medien und auch an mögliche Sponsoren herantreten kann. Wir machten ein Interview, das wir an mehrere Bike-Magazine schickten, offenbar hat es doch Wirkung gezeigt. Zumindest hat er jetzt mit einem Sponsor eine besondere Aktion für Obdachlose umsetzen können. Über die möchte ich euch berichten, weil ich es wirklich stark finde, Reichweite im Netz auf eine solche Weise zu nutzen:
Reichweite im Internet nutzen, um Gutes zu tun. Einige große Youtuber wie LeFloid oder Gronkh tun das mit Spendenstreams wie Loot für die Welt bzw. Friendly Fire, die viele tausend Zuschauer erreichen. Solche Events kann Niko alias NoHandMTB noch nicht auf die Beine stellen. Trotzdem möchte er seine Bekanntheit und insbesondere das Sponsoring durch größere Firmen nutzen, um auch denjenigen Gutes zu tun, die von vielen vergessen werden.
Niko betreibt seinen Youtubekanal NoHandMTB seit etwa zwei Jahren und hat inzwischen mehr als 100.000 Abonnenten. Denen zeigt er Tricks mit dem Bike, mal lustige, mal bekloppte Challenges in Berlin und alles, was sich eben auf zwei Rädern so anstellen lässt. In letzter Zeit werden immer mehr Unternehmen auf ihn aufmerksam, unterstützen ihn beispielsweise mit E-Bikes, die er in seinen Videos testet.
Als der Hersteller Fiido mit ihm Kontakt aufnahm, schlug Niko den Marketing Managern passsend zur Weihnachtszeit eine Spendenaktion für Obdachlose vor. Etwas Ähnliches hatte er auf eigene Kosten schon einmal gemacht, jetzt wurde er dabei unterstützt, insgesamt 500 Euro in warme Kleidung, Decken, Desinfektionsmittel, Zahnpflegeprodukte und einiges mehr zu investieren und die Überraschungspakete mit Hilfe von zwei Freunden an Obdachlose zu verteilen.

Dabei war es dann nicht nur der eigentliche Materialwert, sondern auch die Geste, die Zuwendung, das Gespräch. So vertraute einer der Beschenkten den Jungs an, dies sei sein erstes Weihnachtsgeschenk seit 20 Jahren, denn so lange lebe er schon auf der Straße. Wenn Menschen, die so am Rande der Gesellschaft leben, plötzlich anfangen, aus ihrem Leben zu erzählen, dann sind das Begegnungen, die sich wohl nicht planen lassen, und für junge Influencer ist es die Erfahrung, wie privilegiert sie sind und diese Position nutzen können.
„Neben spaßigen und unterhaltsamen Themen finde ich es wichtig, dass man als Person des öffentlichen Lebens seine Vorbildfunktion wahrnimmt und seine Zuschauer positiv beeinflusst“, sagt Niko. In dieser sieht er sich so oder so, da die sozialen Medien seiner Meinung nach einen Einfluss auf Jugendliche haben wie nie zuvor. „Manchmal würde ich mir wünschen, dass Spendenaktion und gute Taten zum Trend werden würden“, zieht er Bilanz jener Aktion, die vielleicht die Welt nicht rettet, aber da hilft, wo Hilfe benötigt wird.
Er hofft, dass seine Aktion, die er natürlich auch im Video festgehalten hat, viele Nachahmer findet und meint damit sowohl Content Creator als auch Unternehmen, die solche Ideen finanziell möglich machen. So utopisch ist sein Wunsch ja gar nicht, denn bei den eingangs genannten Spendenstreams kommen inzwischen Millionen zusammen und die Initiatoren ziehen von Jahr zu Jahr größere Firmen mit ins Boot. Insofern darf man gespannt sein, wie sich Nikos Idee noch weiterentwickelt.
Nikos Video gibt es hier:
Nikos Kanal findet ihr hier: https://www.youtube.com/@NoHandMTB
Rebekka liebt Sina - Zwei Bräute
Ganz normale Paare - Teil 2
Nur kurz nach dieser Geschichte schrieb ich eine andere, doch ziemlich ähnliche. Diesmal allerdings für die Kirche:
Über gemeinsame Freunde lernten Sina und Rebekka sich damals kennen. Die Freundschaft wurde enger, seit zehn Jahren sind sie nun ein Paar. Ihre Liebe war stark, doch sie wollten auch eine Familie, sprich ein eigenes Kind. Außerdem gab es das eigene Haus, ein weiteres Kind und seit kurzem sind die beiden auch verheiratet.
„So ganz klassisch ist es bei uns ja nicht“, sagen sie lächelnd, „die Reihenfolge ist irgendwie verkehrt herum.“ Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass insbesondere das Kinderkriegen für sie mit mehr Hürden verbunden ist als bei anderen Paaren. Vor allem eben bürokratisch.
Als der Kinderwunsch zwischen beiden ausgesprochen war, entschieden sie schnell, dass Rebekka ihr Kind bekommen sollte und informierten sich über die medizinischen wie rechtlichen und logistischen Möglichkeiten. Bald war ihnen klar, dass sie dafür nach Dänemark gehen wollten, weil dort alles etwas einfacher war als hier. Erst als Rebekka dann wirklich schwanger war, erzählten sie es im Familien- und Freundeskreis, wo die Reaktionen überrascht, aber positiv waren, wie sie heute lächelnd berichten.

Ihr Sohn Lennart wurde geboren, lernte schnell, dass er eben zwei Mütter und andere Kinder Mutter und Vater haben. „Rebekka ist Mama und ich bin Mami“, erzählt Sina. Soweit also alles kein Problem. Wichtig war ihnen, dass der Spender für ihre Tochter Liva der gleiche war wie bei Lennart, damit die Kinder blutsverwandt sind. Auch das kein Problem, vom Stress, Beruf und Kinder unter einen Hut zu bekommen, mal abgesehen.
Doch damit fingen die Probleme im Grunde auch an. Sina hatte nämlich nicht automatisch Rechte an ihren Kindern und um überhaupt das Verfahren für die Adoption einleiten zu können, mussten sie verheiratet sein. Zwar wurden sie in ihrem Umfeld – Sina ist in der Uniklinik in Göttingen und Rebekka Heimleitung im Landhaus am Rotenberg in Pöhlde – unterstützt, doch auf dem Papier hinkt die Gleichberechtigung dem Wunsch noch hinterher.
„Gleiche Rechte gibt es nicht“, sagen beide kühl und erzählen dann von Besuchen des Jugendamtes, das häufig zu ihnen kam, um nach dem Rechten zu sehen und ihnen somit ein Gefühl von Misstrauen vermittelte. Um rechtlich besser dazustehen, muss Sina ihre Kinder adoptieren, doch das kann sie erst, wenn beide verheiratet sind.

Natürlich war das nicht der einzige Grund, warum die beiden sich an Pastorin Alexandra Heimann wandten, um auch diesen bedeutenden gemeinsamen Schritt zu gehen. Sie wollten auf jeden Fall kirchlich heiraten, das ist ihnen durchaus wichtig, genau wie die Taufen für die Kinder. Zu ihrer Überraschung war diesmal alles ganz unproblematisch. „Für mich war es eine Hochzeit wie jede andere“, sagt Alexandra Heimann ganz selbstverständlich.
Rebekka und Sina erinnern sich jedenfalls gerne an diesen großen Tag ihrer Liebe. Beide im weißen Kleid, alles sehr festlich und dennoch locker und authentisch, so beschreiben sie die Trauung. „Es war einfach schön, Alexandra hat das toll gemacht“, sagt Sina und Rebekka fügt hinzu: „Die Kirche ist da offenbar weiter als viele andere, dort wurden wir ganz normal behandelt.“
Schon vor der Veröffentlichung machte ich mich auf Reaktionen auf diesen Text gefasst, unsere Superindententin übrigens auch.
Fortsetzung folgt...
